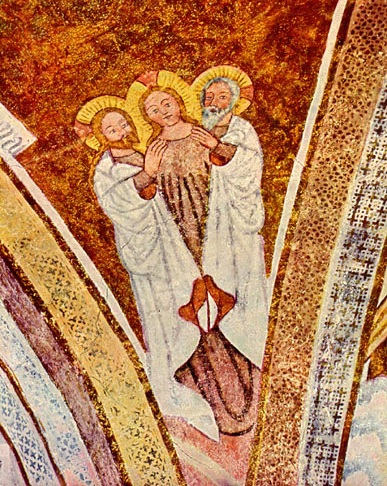Friede – Geist – Leben
Das Evangelium des ‚Weißen Sonntags‘ 2022

An diesem Sonntag hören wir eine – wie ich finde – ganz bedeutsame Stelle aus dem Johannes-Evangelium:
Johannes-Evangelium, Kapitel 20, VV. 19-31
Natürlich fällt uns auf, dass der Mittelpunkt der Erzählung die Begegnung zwischen dem Auferstandenen Jesus Christus und dem ‚ungläubigen‘ Thomas ist.
Doch das möchte ich diesmal nicht in den Blick nehmen.
Dieses Mal möchte ich zentrale Formulierungen anschauen, die – wenn wir sie als Gesamtheit meditieren – eine wichtige Botschaft beinhalten, die der sogenannte ‚1. Schluss des Johannes-Evangeliums‘ hervorhebt.
Dazu möchte ich einfach mal die drei zentralen Begriff aufgreifen, die auch schon in der Überschrift genannt sind.
Friede

Als Christus, der Auferstandene, den Jünger:innen begegnet, sagt er ihnen das Wort: „Friede sei mit euch!“.
Aber nicht nur einmal. Auch ein zweites Mal wiederholt er diesen Satz.
Damit stellt er ihn in die Mitte und macht diese Zusage zu einer zentralen nachösterlichen Aussage.
Ostern und Friede sind untrennbar miteinander verbunden.
Und wenn wir jetzt noch im Hinterkopf behalten, dass die frühen Christen zuerst Ostern und dann viel später auch Weihnachten gefeiert haben, dann wird deutlich, dass der Friede der Heiligen Nacht sich vom Osterfrieden her ableitet.
Doch als wäre es nicht genug mit der Friedenszusage, erneuert Jesus, als er nun auch den vorher abwesenden Thomas begegnet, diese Friedenszusage noch einmal.
Dreimal sagt Jesus in diesem Kapitel seinen Jünger:innen seinen Frieden zu.
Alle, die in diesen Tagen Ostern feiern, ob in der Westkirche vor einer Woche oder an diesem Sonntag in der Ostkirche, müssen sich angesichts des Krieges in der Ukraine aber auch der vielen gewaltsamen Kämpfe auf der ganzen Welt diese Friedensdimension des Osterfestes vor Augen führen.
Wer einen Angriffskrieg führt (auch wenn er ihn mit anderen Begrifflichkeiten umgibt), kann nicht zugleich Ostern feiern!
Wer den Angriffskrieg befürwortet und zugleich Ostern feiern will, lügt und heuchelt und kann nicht glaubwürdig Christ:in sein!
Österliche Menschen hingegen lassen sich von der Friedensbotschaft des Auferstandenen anrühren. Diese Botschaft geht ihnen zu Herzen und lässt eine Haltung zurück, die ‚den Frieden sucht und ihm nachjagt‘ (vgl. Psalm 34,15).
Geist

Die Zusage seines Friedens verbindet Jesus zugleich mit der Sendung des Heiligen Geistes.
Diese Textstelle macht viele von uns stutzig: feiern wir nicht erst 50 Tage nach Ostern das Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes?
Ja, das ist richtig. Aber das hat nur eine liturgische und theologische Funktion.
Die verschiedenen Textstellen aus dem Neuen Testament lassen die Sichtweise zu, dass die Auferstehung, die Himmelfahrt Christi und die Ausgießung des Heiligen Geistes in eins gefallen sind.
Dass wir 40 Tage nach Ostern Christi-Himmelfahrt und 50 Tage nach Ostern Pfingsten feiern ist keine Frage der Chronologie; damit will lediglich die hohe Bedeutung dieses Festkreises zum Ausdruck gebracht werden.
Als die Jünger:innen erkannten, dass Jesus Christus von den Toten erstanden ist und er sein Leben an der Seite seines Vaters weiterführt (Himmelfahrt), war diese Erkenntnis, dieser Glaube das Wirken des Heiligen Geistes, der die Jünger:innen in diese Wahrheit der Auferstehung eingeführt hat.
Für mich wird dadurch deutlich: wer Ostern feiert und um den österlichen Frieden bemüht ist, der wird seine Gebete auch immer an den Heiligen Geist richten, der uns zur Erkenntnis des österlichen Friedens und uns auch ganz konkret auf die Wege des Friedens führen kann und wird.
Leben

Wir feiern an Ostern die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir feiern, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern, wie es in einem Kirchenlied heißt: „der Tod ist tot, das Leben lebt…“
In diesem Jahr, dem Jahr des grauenvollen Angriffskrieges gegen die Ukraine, meditiere ich viel über die Seite des Todes ./. die Seite des Lebens.
Wenn wir das Herz unseres Glaubens verstehen wollen, dann benötigen wir Bilder, die uns bildlich und klar deutlich machen, was der Kern unseres Glaubens ist.
Mir hilft in diesem Jahr die Gegensätze
Seite des Todes ./. Seite des Lebens
in den Blick zu nehmen.
Die zentrale Botschaft von Ostern ist:
„… Jesus hat den Tod bezwungen und uns allen Sieg errungen…“
(vgl. das Kirchenlied: „Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da …“)
Für mich bedeutet das, dass der wirkliche und echte Sieg der ist, der nicht auf der Seite des Todes steht, sondern wo alles Leben leben darf und kann.
Natürlich weiß ich auch, dass auf Erden letztlich alles dem irdischen Tod anheim fällt.
Aber österliche Menschen werden diesem Tod nicht noch Vorschub leisten durch Angriffskriege, durch Gewalt, Totschlag und Mord.
Österliche Menschen wenden sich in gleicher Weise gegen den physischen wie den psychischen Tod, der oft einhergeht mit sexualisierter Gewalt, seelischen oder geistlichem Missbrauch.
Österliche Menschen dienen dem Leben und leben für das Leben, von dem Jesus uns sagt, dass er gekommen ist, damit wir „das Leben haben und es in Fülle haben“. (Johannes-Evangelium Kapitel 10 Vers 10)
Quintessenz:
In diesen Wochen, gerade auch angesichts des Krieges gegen die Ukraine, wird mir im Hinblick auf Ostern immer deutlicher
Österliche Menschen suchen den Frieden und jagen ihm nach.
Österliche Menschen lassen es zu, dass sie den Heiligen Geist empfangen und sind offen für sein Wirken und Wehen und bitten um SEINE Gaben.
Österliche Menschen sind immer auf der Seite des Lebens, für das Leben und gegen den Tod in seiner Mannigfaltigkeit .Gerd A. Wittka, 24.04.2022, Weißer Sonntag – Sonntag der Barmherzigkeit