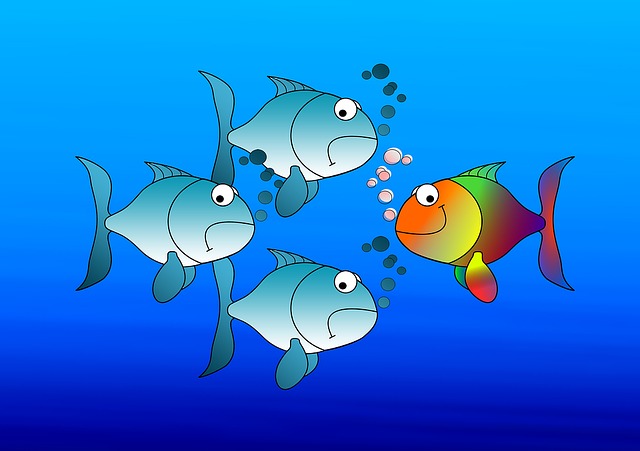„LSBTIQ* willkommen!“

Zum „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit“ (IDAHOBIT) am 17. Mai
Das Queere Netzwerk NRW hat in diesem Jahr zum „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit“ (IDAHOBIT) Communities und Verbündete aufgerufen, ein Zeichen für LSBTIQ*-freundliche Orte und Institutionen (und damit gegen alle Formen der Queerfeindlichkeit) zu setzen.

Über die Vermittlung des Bistums Essen wurde ich angefragt, ob ich mit anderen Personen aus unserer Pfarrei ein solches Willkommens-Zeichen setzen möchte.
Ich arbeite seit Mitte der 1990er Jahre in einer kirchlichen HIV-Beratungsstelle und bin seit 2019 von unserem Bischof gebeten worden, als röm.-katholischer Partner beim ökumenischen Gottesdienst zum ‚RuhrPride Essen'(CSD) mitzuwirken.
Recht spontan haben sich auf Initiative von Pastoralreferentin Tabea Diek und mir einige Personen aus der Pfarrei gefunden (die Ehepaare Iris und Carsten E. und Malte und Andreas G.; sowie Stephan B., Egbert P., Tabea Diek mit Benjamin und Samuel, sowie Martina D. mit Victoria D. und Vincent D. und Gerd Wittka), mit einer Fotosession ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit zu setzen.

Die Fotos entstanden auf dem Außengelände der Gemeindekirche St. Barbara in Oberhausen-Königshardt, welche zur Propsteipfarrei St. Clemens, Oberhausen-Sterkrade gehört.
Eintreten für das, was eine Selbstverständlichkeit ist
Damit unterstreichen sie, dass das Diskriminierungsverbot – schon im Grundgesetz verankert – auch eine Verpflichtung für die eigene Kirche ist und deshalb eine echte, aufrichtige und herzliche Willkommenskultur für ‚Queerpeople‘ in unseren Kirchen, Pfarreien, Gemeinden und Verbänden selbstverständlich sein muss.

Diese Aktion wirbt sowohl nach außen, verweist jedoch mindestens genauso in die eigene Kirche; denn auch hier muss eine queere Willkommenskultur, die auf Achtung und Respekt beruht und jeglicher Diskriminierung eine Absage erteilt, weiter ausgebaut und kultiviert werden.
Die in vielen Pfarreien stattgefundenen Partnerschaftssegnungen für Menschen verschiedener Sexualitäten ist in diesen Tagen ein Baustein für eine solche Veränderung der queeren Willkommenskultur in unserer Kirche.
Noch ein Text von Vicky, den sie mir gestern nach unserer Aktion zugeschickt hat und den ich hier veröffentlichen darf!
Danke, Vicky!
Homophobie
Ist die Welt für manche Menschen wirklich so schwarz weiß, dass es nicht in Ordnung ist, wenn gleichgeschlechtliche Paare auf der Straße rumlaufen?
Warum wird Religion genutzt um gegen Homosexualität zu argumentieren, wenn es Gott am meisten darum geht, dass wir uns lieben?
Niemand sucht sich aus, in wen er sich verliebt. Ob Mann, Frau oder kein Geschlecht, das suche nicht ich mir aus, sondern mein Herz.
Liebe ist Liebe und im 21. Jahrhundert sollte das toleriert werden.
Niemand zwingt dich dazu diese Menschen anzustarren oder ähnliches. Genauso, wie dies niemand bei heterosexuellen Paaren macht.
Es ist genauso „normal“.
Denn es ist genau das gleiche.
LIEBE
Egal ob Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann!
( © Victoria Duckscheidt, Oberhausen, 2021)
Danke an alle fürs Mitmachen!
Es war eine tolle Aktion. Und ich durfte in diesen Tagen einige Gespräche führen, die gezeigt haben, dass solche Themen auch in unserer Pfarrei akut sind und manche Leute es nicht hinnehmen, dass es dafür so wenig Raum gibt!