Eher suchen anstatt finden
Glaube
ist für mich mehr
zu suchen,
als
etwas gefunden zu haben.
(Gerd Wittka, 05.04.2021)
Glaube
ist für mich mehr
zu suchen,
als
etwas gefunden zu haben.
(Gerd Wittka, 05.04.2021)
Gerade in Zeiten wo vieles in unserem Leben still zu stehen scheint, ist mir das Evangelium vom Ostersonntag besonders unter dem Aspekt der Bewegung aufgefallen.
Ich möchte heute einige Passagen dieses Evangeliums etwas genauer anschauen …
Die Verse Johannes 20, 1-3.11-16 berichten von dem Ostergeschehen, wie es Maria Magdala er-fahren hat.
Fassen wir kurz zusammen:
Maria Magdala macht sich auf dem Weg zum Grab. Dort sieht sie das offene Grab; der Stein ist fort. Sie schaut nicht ins Grab sondern eilt sofort zurück zu Petrus und Johannes (!) und berichtet ihnen, was sie gesehen hat. (Dann laufen Petrus und Johannes zu Grab; was sie erleben: dazu später.)
Auch Maria Magdala geht in ihrer Trauer zum Grab zurück. Petrus und Johannes waren nicht mehr dort. Jetzt schaut auch Maria weinend ins Grab, findet den Leichnam nicht. Stattdessen sieht sie einen Engel, der sie nach dem Grund ihrer Trauer fragt. Sie erklärt, dass sie den Leichnam Jesu vermisst und ihn sucht, dann schaut sie sich um und sieht Jesus, erkennt ihn aber nicht.
Auch von ihm gefragt, was sie suche, bekennt sie auch ihm ihre SEHN-SUCHT. Sie öffnet in ihrer Trauer ihr Herz – vermeintlich gegenüber einem Fremden – und gesteht ihm ihre Sehnsucht.
Und der UNERKANNTE antwortet ihr, indem ER sie nur bei ihrem Namen nennt.
Sie wird von ihm mit ihrem Namen angesprochen, was ihre ‚Identität‘ ist, SIE ist gemeint.

In dieser vertrauten Ansprache erkennt sie nun Jesus, ihren Herrn und Meister.
Als sie IHM ihr Innerstes offenbart, ihren Schmerz, ihre Trauer, ihr Erschrecken, da offenbart ER SICH ihr.
Welche Aspekte scheinen mir auf?
Nach dem Tod Jesu verfällt Maria nicht in Lethargie, sie verkriecht sich nicht. Sie weiß, was zu tun ist. Uns so geht sie zum Grab. Dort ist auch für sie der Ort, wo sie mit ihrer Trauer sein kann, in der Nähe ihres geliebten Herrn. Doch sie findet ihn nicht mehr. Konsterniert berichtet sie den Jüngern Petrus und Johannes.
Aber das reicht ihr nicht; sie gibt sich mit dem offenen Grab nicht zufrieden. Es kann nicht sein, dass von ihrem Herrn gar nichts mehr geblieben ist. Wohin nun mit ihrer Trauer. Sie muss selber Einblick haben in diese unfassbaren Geschehnisse. Sie will sich damit nicht abfinden, dass ER nun weg sein sollte, ganz und gar.

Und sie folgt ihrer Sehn-sucht; sie sucht IHN zu sehen.
Doch die Trauer und die Sehnsucht zeigen ihr nur ein verschwommenes Bild, sie sieht nicht klar. Aber sie nimmt dennoch was wahr: sie ist nicht allein mit ihrer Trauer. Ein Engel zeigt sich ihr, ein himmlischer Bote, dem sie ihre Botschaft der Trauer und Sehnsucht sagt. Gesagt – getan: Nachdem sie ihre Trauer ausgedrückt hat, kann sie von sich absehen, sich umdrehen, ihre Blickrichtung wieder ändern.
Und da geschieht nun das unglaubliche und unbegreifliche: sie begegnet Jesus, den sich aber noch nicht erkennt.
Es ist noch einer weiterer Schritt nötig, heraus aus ihrem Schneckenhaus der Trauer und der Sorge.
Ihr Coming-out gegenüber dem vermeintlich ‚Fremden‘ stellen die Basis für eine Begegnung dar, die so tief ist, dass sie vom vermeintlichen Gärtner erkannt und in ihrer Sehnsucht wahrgenommen wird.
So wird sie von IHM mit der vertrauten Anrede „Maria“ angesprochen.
So kann sie nur jemand ansprechen, der sie durch und durch erkennt. So kann sie nur jemand ansprechen, der ihr doch so vertraut geworden ist; so vertraut, dass der Schmerz der Trauer über seinen Tod so unerträglich ist.
Da erkennt Maria ihren Meister und Herrn und sie begreift, was da geschehen ist, der Tote ist nicht mehr tot, der Tod ist tot, das Leben lebt, ihr Herr und Meister ist auferstanden.
Marias Verhalten ist so ermutigend: sie überlässt sich ihrer Trauer und ihrem Schmerz, aber sie vergräbt sich nicht; sie versucht, ihr Leben weiterzuleben, irgendwie, mit ihrer Trauer.
Und sie steht zu ihrer Trauer, zu ihren Gefühlen, die der Tod des geliebten Jesus bei ihr hinterlässt. Sie schließt sie nicht ein in ihrem Trauerprozess und scheut sich nicht davor.
Hier, wo das intimste der Trauer offenbar wird, hier wo die Sehnsucht keine oberflächliche ist, da ist die Begegnung mit dem Auferstandenen erfahrbar.
Mir macht dieses Evangelium Mut; es macht mir Mut, in diesem Jahr, wo wir zum zweiten Mal so ungewöhnlich Ostern feiern, das auch scheinbar unsere Sehnsucht nicht stillen kann, den Schmerz und die Trauer offen zu zeigen, sie nicht zu verstecken, nicht zu ignorieren, weil sie eine wesentliche Quelle unseres eigenen Lebens offenbart: die Liebe.
Ich wünsche uns allen, dass gerade in Zeiten der Trauer unsere Sehnsucht nach Christus nicht erlischt; dass wir weiterhin suchen. Und dass ER auch uns dann begegnet, uns ganz persönlich anspricht und uns damit zutiefst berührt und uns zur Erkenntnis führt:
ER lebt, und auch wir sollen leben!
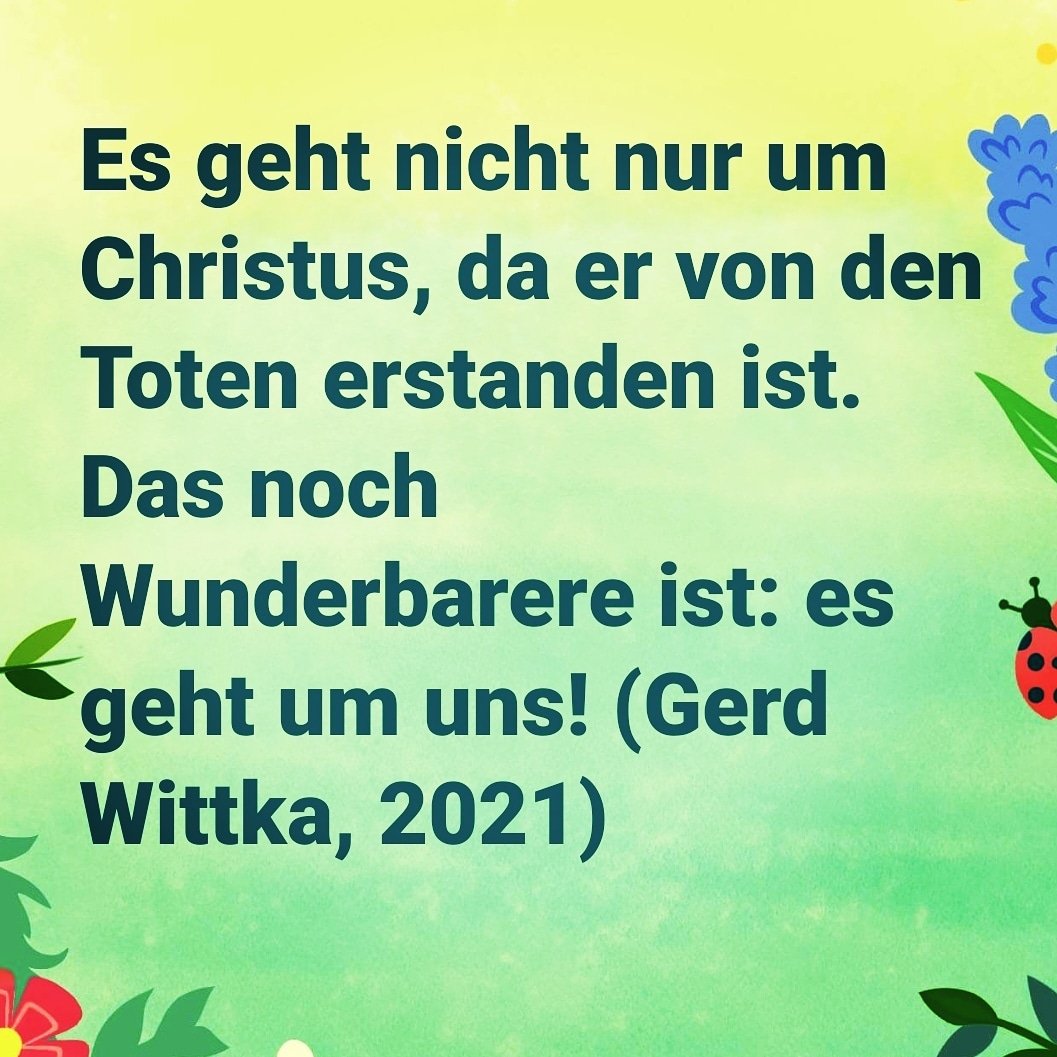
„frohe Ostern“ – kommt mir nicht so recht über die Lippen
Um es gleich vorweg zu nehmen: nein so richtig froh bin ich an diesem Osterfest nicht. Die „Freude“ steht mir nicht ins Gesicht geschrieben.

Jetzt könnte ich gleich den zweiten Schritt vor dem ersten machen und von meinem Glauben an die Auferstehung, von meinem Glauben an das ewige Leben schreiben, dass bei allen Umständen dennoch mein Glaubesgrund ist.
Aber ich möchte es wagen, doch erst einmal dabei etwas zu verweilen, warum mir der Gruß „Frohe Ostern!“ in diesem Jahr doch so gar nicht durch den Kopf geht und über die Lippen kommt.
Ich finde, es ist gut, nicht darüber einfach hinweg zu gehen, macht mich doch meine heutige Stimmung auf etwas aufmerksam, was mir fehlt, wonach ich mich sehne.
Und dann kommt die Frage, welche Bedeutung es für mich hat und wie ich dennoch auch in diesem Jahr Ostern ‚feiern‘ kann?
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!“ – dieser Zuruf gilt auch heute, Ostersonntag 2021. Die Wahrheit bleibt. Doch was sich ändert, ist, wie diese Wahrheit bei mir ankommt, mich erfüllt.
Immer wieder kommen mir Bilder des Alten Bundes in den Sinn. Da lese ich von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Babylonier.
Stadt und Tempel waren mehr als nur Gebäude für das Volk Israel. Ihnen wurde ihre geographisches, ihr sozial-politisches und kulturell-religiöses Glaubenszentrum genommen. Es liegt in Schutt und Asche. Große Teile des Volkes sind nach Babylon verschleppt und geraten dort in Gefangenschaft (-> Babylonisches Exil)
Der Ort des Tempels war der Raum, wo das Allerheiligste stand, wo „Gott seine Wohnstatt unter den Menschen“ hatte.
Warum, so frage ich mich, kommen mir diese alten Erzählungen in den Sinn?
Weil ich spüre, dass mir durch die Corona-Pandemie auch solche „Orte“ des Glaubens genommen worden sind. Sie sind zwar nicht endgültig verschwunden, aber sie machen das vertraute Glaubensleben schwer wenn nicht gar unmöglich.
Ich bin so kirchlich sozialisiert, dass Gottesdienste für mich wesentliche Quellen der geistlichen Zurüstung sind. Sicherlich gibt es dafür auch andere ‚Orte‘. Aber gewiss ist die Liturgie der Kar- und Ostertage in ihrer Einmaligkeit für mich ganz wichtig, das spirituelle Zentrum von Ostern zu erspüren.
Sicherlich kann man einwenden: damals war der Tempel nicht mehr. Doch heute ist das bei uns ganz anders. Wir machen unseren Glauben doch nicht an Orten fest! – Das ist richtig.
Und dennoch bringen wir unseren Glauben ritualisiert in unserer Kirche zum Ausdruck: in den verschiedensten Feiern und Formen von Gottesdiensten.
Ja, es ist richtig, dass in der Corona-Pandemie eine Vielzahl an Gottesdiensten angeboten wird: Gottesdienste ‚aus der Konserve‘, die man sich gleichsam wie aus einer Mediathek zu jeder beliebigen Zeit vorspielen lassen kann; sogenannten „livestreaming“-Gottesdienste, wo in einer Kirche ein Gottesdienst gefeiert wird und wir in Echtzeit über eine Videoschalte an diesem Gottesdienst ‚teilnehmen‘ können.
Für mich ist Letzteres aber keine wirklich Teilnahme. Meine Gottesdienstteilnahme lebt von Interaktion; ist echte personale Begegnung, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit und ‚aus der Bank‘ heraus; ist Gemeinschafterfahrung indem ich andere Menschen mit mir in Raum und Zeit wahrnehme.
Alles das können Gottesdienste ‚aus der Konserve‘ oder sogar Livestreaming-Gottesdienste für mich nicht leisten.
Jetzt könnten noch einige einwenden: Du bist doch Priester. Kannst du nicht ausnahmsweise eine Privatmesse „missa sine populo“ feiern?
Meine Antwort ist ganz klar: NEIN!
Auch für mich ist die Teilnahme und Mitfeier der Gemeinde wesentlicher Bestandteil eines Gottesdienstes und besonders der Eucharistie. (Natürlich gibt es Gottesdienste, die ich „allein“ feiere: ich denke da nur an die Tagzeitenliturgie, …)
Aber eine Eucharistie ohne interagierende Gemeinde ist für mich nicht denkbar.
Eine Form des Gottesdienstes, die auch gerade in unserer modernen Zeit möglich ist, ist ein ‚interaktiver Online-Gottesdienste‘ z.B. mittels ZOOM-Meeting-Platform.
Am Gründonnerstag hat mein Kollege in der Krankenhaus-Seelsorge und ich einen solchen Gottesdienst vorbereitet und durchgeführt.
Bei dieser Form kam etwas wie ein Wir-Gefühl auf; wir konnten vorher miteinander reden und auch sehen (Video); während des Gottesdienstes gab es ein Predigtgespräch und auch frei formulierte Fürbitten. Und anschließend ’saßen‘ wir noch bei einer Agapefeier beisammen.
Bei entsprechender Gestaltung des Umfelds in der Nähe des PC/Laptop etc. kommt dann auch Gemeinschaftgottesdienstcharakter zustande.
Am Karfreitag und auch in der Osternacht war diese Form nicht möglich, weil uns einfach die Zeit zur sorgfältigen Vorbereitung fehlte.
Abgesehen von der Tagzeitenliturgie und einer Kreuzweg-Betrachtung am Karfreitag war es das mit Gottesdiensten für mich in den Kar- und Ostertagen.
Dies ist schade und traurig; dadurch stellt sich bei mir – auch in diesem Jahr wie im letzten – kein richtiges Osterfeeling ein, was mir sonst mit der Mitfeier der Liturgie widerfahren ist.
Daher drängt für mich die Frage:
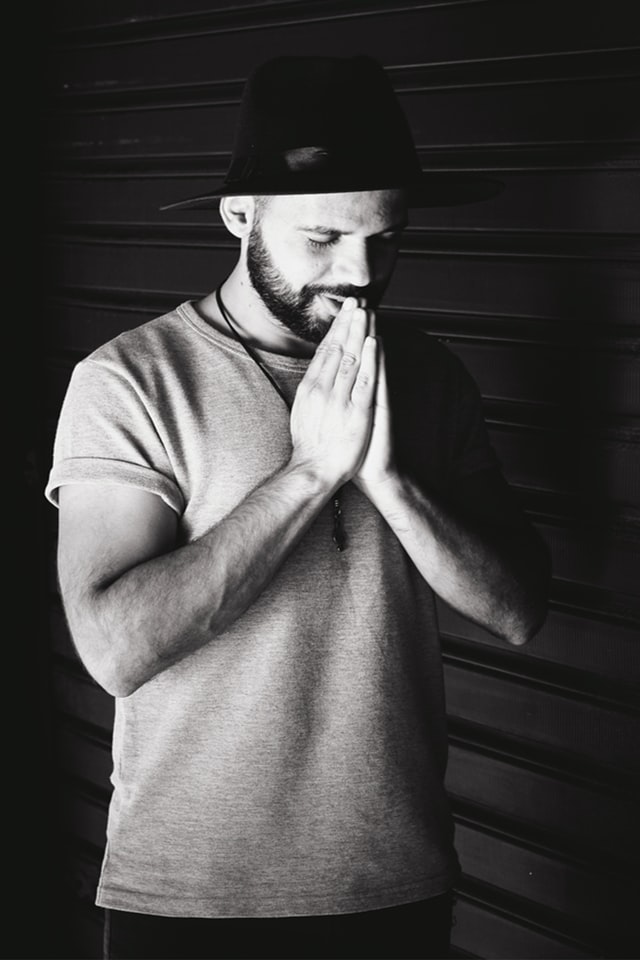
Diese Frage kann ich gar nicht jetzt schon abschließend beantworten. Ich habe nur eine Ahnung und Impulse, die mir durch den Kopf jagen:
Bei diesem Osterfest kommt es mehr noch auf die gläubige Sehnsucht an, als auf das rituelle Erleben.
Österliches Gebet und österlicher Lobpreis wird vereinzelt und verinnerlichter vollzogen sein.
Denn: wenn sich auch äußere Umstände, die vertrauten, so radikal verändert haben: die Botschaft von Ostern ist und bleibt unveränderlich:
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!“
Ich möchte diese Botschaft wieder einmal in meinem Leben verinnerlichen, mir ein-ver-leib-en.
Ich wünsche und hoffe, dass diese Botschaft in mir den Mut und Impuls verstärkt, mich auf das Leben einzulassen und es als „neues“ Leben zu wagen.
Wir gut, dass die Osterzeit insgesamt fünfzig Tage dauert: da bleibt mir noch etwas Zeit, mich geistlich neu einzufinden in dieses Fest!

Im zweiten Jahr werden wir in diesem Jahr Ostern unter Coronabedingungen feiern.
Eigentlich müssten wir schon Übung daran haben, aber dennoch erscheint es uns weiterhin unwirklich und fremd.
Vieles vermissen wir schmerzlich.
Darunter auch viele gute Gewohnheiten und Begegnungen.
Dazu kommen neue Herausforderungen und Belastungen, die unserem Alltag eine andere Prägung geben, als wir es bisher gewohnt sind.
Als Seelsorger bekomme ich das selber zu spüren.
Ressourcen, die ich vorher gewohnt für bestimmte Dinge und Aufgaben zur Verfügung hatte, muss ich nun neuen Herausforderungen widmen.
Das hinterlässt bisweilen auch Unzufriedenheit oder gar Enttäuschungen, weil Erwartetes nicht erfüllt wird und erfüllt werden kann.
Diese Erfahrung ist für mich genau der Punkt, wohin ich in diesem Jahr meinen österlichen Sinn ausrichten möchte:
in Mitten von all dem, was niedergeht, jenes in den Blick zu nehmen, was zugleich an Neuem geschieht.
Denn wir fallen durch die Veränderungen ja nicht in ein Vakuum, auch wenn sich das manchmal so anfühlt.

Es ist keine Leere, sondern eher das Gefühl, dass Vertrautes nicht mehr da ist;
einfach verschwunden, oder überdeckt.
So entsteht für mich keine Leere, sondern ein Freiraum, der neu gefüllt werden darf.
Dieses neue Leben möchte ich an diesem Osterfest besonders in den Blick nehmen und feiern.

Den geschenkten Freiraum für was Neues, damit Altes ruhen kann – vielleicht sogar losgelassen werden kann, weil am Ende nicht nichts steht, sondern mich anderes, verwandeltes Leben erwartet.
Ich wünsche uns allen in diesem Sinne ein gesegnetes und gnadenreiches Osterfest und die Freude über den Auferstandenen.
Neue Impfstoffe
wagen es mit uns
gegen Vir Corone
in diesem Jahr nicht leicht
und nicht ganz ohne
— mutig Richtung Ostern gehn
und — so erinnern heute
weise Leute — können wir
auf diesem Weg — ganz neu
— statt schimpfend untergehn
Vir Corone — aktuell
auch im Karfreitag´21 sehn
und mit Ostern auferstanden
— krisenfester weitergehn
GEBETdabei dankend acht
was wir schon mit-und füreinander
durchgemacht — so können wir bei
weiterem Corona-Reinemachen
impfgestärkt auch
— weiter lachen
Klaus Jäkel, In: Pfarrbriefservice.de
Mein Dienst gilt Gott und den Menschen.

Die Kirche nimmt mich dafür in den Dienst.
Die Prioritäten, die sich daraus ergeben, sind klar.
Dazu passt auch folgender Bericht: https://neuesruhrwort.de/2021/03/31/bischof-meier-kritisiert-priesterbild/