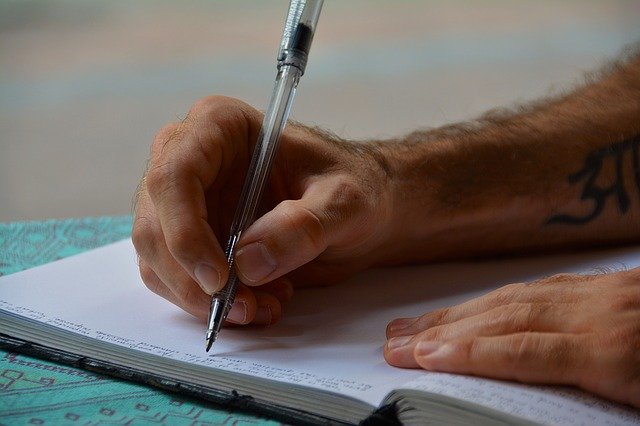Selig sind …
Gedanken zu Allerheiligen in der Corona-Pandemie 2020

Wir in unserer römisch-katholischen Kirche leben mit ihnen, den unzähligen Heiligen, nach dem das heutige Fest benannt wurde.
„Selig sind, …“ – sind damit vielleicht jene gemeint, die nach dem Verständnis der Kirche als Vorstufe der Heiligen angesehen werden, die Seligen?
Wohl kaum, liebe Schwestern und Brüder; damit hatte Jesus offensichtlich wenig am Hut.
Wenn Jesus Menschen selig nennt, dann nicht, um ihnen eine besondere Form der Verehrung entgegen zu bringen.
Wenn Jesus Menschen selig nennt, dann, um sie zu ermutigen und zu stärken:
jene Menschen, die sich letztendlich allein bedürftig sehen vor Gott. Die in der Welt leben in dem Bewusstsein, dass nur Gott sie wirklich erfüllen und reich machen kann.
jene Menschen, die trauern; die trauern über einen geliebten Menschen, die trauern über den Verlust dessen, was ihnen im Leben wichtig war, ihnen Mitte gab; die aber auch trauern über Verluste in unseren Gesellschaften und in unserer Welt; die trauern über verloren gegangene Solidarität und Gemeinsinn; die trauern über verloren gegangene Teile der Schöpfung, seien es Geschöpfe oder ganze ökologische Systeme; die trauern, weil sie den Verlust nicht aufhalten oder ihm etwas entgegensetzen konnten.
jene, die in einer Welt der Ellenbogen-Mentalität Sanftmütigkeit oder Barmherzigkeit walten lassen.
jene, denen die unzähligen Facetten von Gerechtigkeit ein Herzensanliegen sind und sich danach sehnen, dieser Gerechtigkeit immer mehr Raum und Gewicht zu geben.
jene, für die der Friede nicht nur die Abwesenheit von Krieg, Terror und Gewaltkriminalität bedeutet, sondern eine grundlegende Form des Miteinanders, sodass Hass, Neid und Diskriminierung überwunden werden.
jene, die in ihrer guten Gesinnung Benachteiligung ausgesetzt oder gar verfolgt werden.
Eigentlich all jenen Menschen, die in ihrer Lebenssituation konkrete Worte der Hoffnung und des Mutes brauchen.
Auch heute – in den Zeiten der Corona-Pandemie – kommt es wieder auf solche Seligpreisungen an.
Heute kommt es darauf an, dieses Evangelium neu und ganz konkret in unsere Zeit zu übersetzen.

Viele Menschen leiden körperlich, seelisch, aber auch wirtschaftlich und sozial unter dieser Pandemie.
Und wir ahnen alle gemeinsam, dass wir noch eine lange Durststrecke vor uns haben.
Was wird da wichtig?
Wichtig wird, dass jenen Mut und Zuversicht gemacht wird, denen es daran fehlt.
Wichtig wird, dass wir uns untereinander bestärken, durch einen wohlwollenden und liebevollen Umgang miteinander.
Wichtig ist es, uns gegenseitig zuzugestehen, dass bei dem einen oder der anderen auch mal die Nerven blank liegen und wir deshalb einmal mehr manch schroffes Wort nicht auf die Goldwaage legen, da wir wissen, dass dieser Mensch sonst anders ist.
Wichtig wird, dass denen materielle Hilfe zuteil wird, die darauf angewiesen sind.
Wichtig wird, dass wir einander stärken und uns nicht aus den Augen verlieren.
Ich möchte das mal an einem konkreten Lebensbeispiel von mir verdeutlichen:
Als ich im Januar 1982 mit dem Abendgymnasium begann, das berufsbegleitend stattgefunden hat, waren wir insgesamt 50 Studierende, wobei ich damals mit noch 18 Jahren der „Benjamin“ unter ihnen war. Die anderen waren z.T. deutlich älter.
Unter diesen 50 NeuanfängerInnen hatte sich eine Clique gebildet von fünf Mitstudierenden, der auch ich angehörte. Fehlte einer von uns mal an einem Abend bei Unterricht (der oft bis 21.45 Uhr ging), kam spätestens am nächsten Tag ein Anruf von jemand anderem aus der Clique und es wurde gefragt, warum man nicht da war? Gab es keinen trifftigen Grund, außer, dass man z.B. zu kaputt von der Arbeit war, dann wurde einem wohlwollend klargemacht, dass man heute wieder zu erscheinen habe.
So haben wir gegenseitig auf uns geachtet und sind allesamt bis zum Abitur am Ball geblieben.
Das war für mich eine prägende Erfahrung dafür, was es heißen kann, andere mitzunehmen.
So in etwa denke ich, könnten wir auch in diesen Tagen füreinander da sein, wir hier in unserer christlichen Gemeinschaft aber auch ganz besonders für jene, die nicht in unseren Reihen sind – vielleicht gerade für diejenigen, die sonst auf sich allein gestellt sind.
Jesus hat damals den Menschen, die in Nöten waren, Hoffnung machen wollen.
Heute sind wir es, die den Menschen sagen und zeigen können, dass auch sie getröstet oder satt werden und das Licht am Ende des Tunnels erwarten dürfen, durch den wir alle gemeinsam und zusammen gehen.