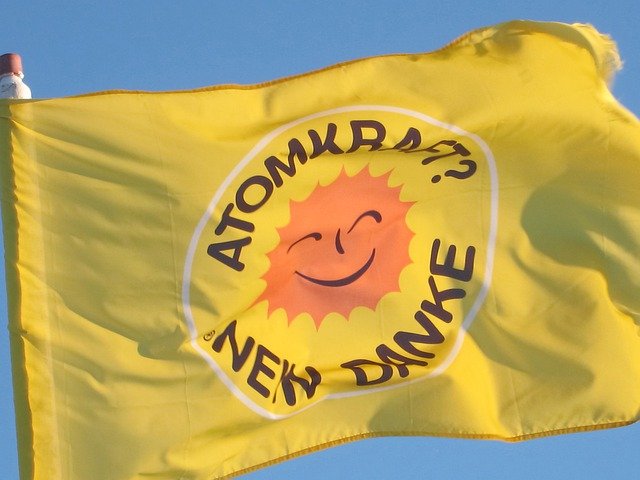Energiewende beginnt bei mir
Sparen und selber produzieren
Seit über 15 Jahren beziehe ich schon Ökostrom.
Dennoch ist für mich das Ende der Fahnenstange nicht erreicht.
Strom zu sparen, ist weiterhin mein Ziel. Das verwirkliche ich durch unterschiedliche Maßnahmen, die ich hier alle nicht aufzählen will.
Wer sich mit dieser Thematik beschäftigt, weiß, wo und wie man selber im Alltag Strom sparen kann.
Nun hatte ich aber – ich gestehe es – die fixe Idee bekommen, ob ich nicht selber auch Strom produzieren kann?
Solartechnologie interessiert mich schon seit Jahren, und seien es nur Powerpacks, die ein Solarpanel haben und ich auf der Fensterbank den Strom für mein Smartphone produziere.
Aber auch Solarlampen auf dem Balkon gehören seit Jahren zu meinem Bestand.

Ende des letzten Jahres habe ich deshalb beschlossen, eine neue Stufe zu erreichen:
mittels eines größerem Solarpanels und einer Powerstation selber Strom zu produzieren, den ich dann z.B. für den Betrieb des Laptops, für kleiner Lampen, für Ventilatoren bis hin zum Laden des Akkus fürs eBike nutzen kann.
Heute habe ich eine neue Etappe erreicht:
Ein Solarpanel wurde auf dem Balkon erreichtet und die Leitung dazu gelegt. In der Wohnung wird nun mit dem produzierten Strom eine Powerstation von ANKER gefüttert.
Dies ist zwar nicht der effizenteste Weg Energie zu produzieren und zu speichern, aber ein Balkonkraftwerk, das den Strom direkt ins Netz meines Haushalts speist, ich leider technisch bei mir nicht sinnvoll.
Das Solarpanel hat heute ab spätem Vormittag bis jetzt, 15.00 Uhr im Durchschnitt gut 85 Watt pro Stunde eingespeist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

Ein Anfang ist gemacht und mit etwas Kreativität gibt es bestimmt noch einige Möglichkeiten, wo wir selber die Energiewende unterstützen können.