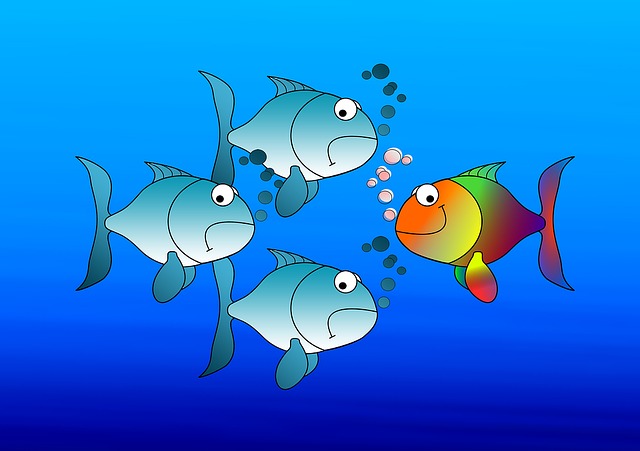Glauben heißt …

„Glauben heißt:
die Unbegreiflichkeit Gottes aushalten
– ein Leben lang.“ (Karl Rahner SJ)
Dieses Wort stand über den Freitag, 20. Mai 1994, als fünf Männer aus dem Bistum Essen durch Bischof Hubert Luthe zu Priestern geweiht wurden; einer von ihnen war ich.
Dieser Tag war ein warmer Mai-Frühlingstag. Bis zum Frühstück waren wir noch bei den Benediktinerinnen von Köln-Raderberg. Bei Sr. Otgera Kremer OSB hatten wir unsere einwöchigen Weiheexterzitien.
Der Weihespruch, das obige Wort von Karl Rahner SJ, begleitete uns dabei.
Ich erinnere mich daran, dass Sr. Otgera dieses Wort aufgriff und sinngemäß fragte: „Wisst ihr eigentlich, was für ein Wort ihr da für euch und eure Weihe ausgesucht habt? … Ihr werdet lernen, es mit eurem Leben zu bezeugen…“
Als wir uns im Weihekurs dieses Wort ausgesucht hatten, fiel es uns relativ leicht. Heute denke ich, dass wir unbewusst schon etwas von der ‚Wahrheit‘ dieses Wortes erahnt haben, ohne uns aber der konkreten Herausforderungen dieses Wortes gegenwärtig zu gewesen zu sein.
Vielleicht lag genau darin das besondere in diesem Wort: eine Ahnung von der ‚Richtigkeit‘ zu haben, ohne zu wissen, was auf uns zukommen wird.
Doch das würden wir schon sehr bald erfahren.
Ad exemplum: die erste Kaplan-Stelle
Für mich war das die Situation in meiner ersten Gemeinde als Kaplan: eine sehr bürgerlich geprägte Pfarrei. Mein Pfarrer hatte es nicht leicht, weil der ‚Geist‘ seines Vorgängers immer noch – nach Jahren – über der Pfarrei schwebte; ständig wurde er und ich daran erinnert: „Damals, bei Pfarrer X.Y….“ – Das Wort „damals“ schien irgendwie prägend gewesen zu sein: die Pfarrei war lebendig, ohne Zweifel. Aber es war vieles festgefahren. Uns wurde gesagt, wie man es „schon immer“ gemacht habe (… und wir auch gefälligst weiter so zu machen haben…“).
Doch diese Zeiten waren vorbei; sie waren deshalb schon allein vorbei, weil ich von Bischof Luthe gesagt bekommen hatte, dass ich in dieser Pfarrei der letzte Kaplan sein würde und es gut wäre, wenn ich meinen Arbeitsbereich dafür fit machen würde. (Schon damals war klar, dass es Veränderungen und Umstrukturierungen geben würde.)
Doch alteingesessenen Pfarreimitgliedern stieß das sauer auf. Das merkte ich z.B. daran, als ich dran ging, die beiden großen Jugendverbände, die dort waren, eigenständiger werden zu lassen.
Die Frage nach der geistlichen Leitung ohne einen Kaplan stand an.
Es ist schon irgendwie komisch, wenn man an eine Stelle versetzt wird mit dem „Auftrag“ sich überflüssig zu machen. Ich hörte Gerüchte, dass ich zu faul sei und mich nicht mehr um die Jugend kümmern würde. Irgendwann gab es auch mal heftige Auseinandersetzungen im Pfarrgemeinderat (PGR).
Ich erinnere mich nicht mehr an Einzelheiten, aber der Krach war so groß, dass sich bei der nächsten PGR-Wahl einige „alteingesessene“ nicht mehr zu Wahl stellten.
Das war belastend, aber im Nachhinein habe ich das als große Chance wahrgenommen. Denn bei der nächsten Wahl kamen engagierte Christ:innen in den Pfarrgemeinderat, die vorher überhaupt dazu keine Chance hatten. Und nach der Wahl spürte ich eine merkliche positive Veränderung: den Geist der Wandlung und kleinen Erneuerungen.
Auch die Jugendlichen, die sich darauf eingelassen haben, haben mich dabei unterstützt. Dabei sorgten diese Veränderungen auch bei ihnen für zeitweise großen Stress. Durch Personalveränderungen im Vorstand eines Verbandes kam es zu einem buchstäblichen „Machtvakuum“; und wer sich mit gruppendynamischen Prozessen auskennt, weiß, dass dann Prozesse beginnen, wo versucht wird, dieses Vakuum wieder zu füllen. Und das geht nicht ohne Konflikte. Ich erinnere mich sehr gut an einer Sitzung, wo wir bis früh morgens fast um 3 Uhr getagt haben, weil eine Lösung gefunden werden musste (und sie wurde dann auch gefunden).
Nach einigen Monaten gelang es uns aber, die Strukturen so zu verändern, dass nun Menschen in Verantwortung in beiden Jugendverbänden kamen, die es mir möglich erscheinen ließen, dass sie später auch ohne einen Kaplan auskommen konnten. Das empfinde ich im Nachhinein als einen großen Erfolg. (btw: Zum ersten Mal übernahm eine geistlich erfahrene Frau und Mutter dort die Aufgabe der ‚Kuratin‘ bei der dortigen DPSG.)
Wenn man heute auf die Seite der Pfarrei geht (die zwischenzeitlich mit früheren anderen Pfarreien zusammengelegt wurde), dann sieht man, dass es die beiden großen Jugendverbände noch immer gibt und diese ziemlich aktiv sind. Das freut mich immer noch, weil es zeigt, dass ich nichts ‚kaputt‘ gemacht habe. (Heute würde mich interessieren, was so aus der geistlichen Leitung geworden ist und welche Akzente und Impulse es dort noch gibt?)
Doch dieser ‚Erfolg‘ hatte seinen Preis: in dieser Zeit erkrankte ich an eine psychovegetative Funktionsstörung des Dames (Reizdarm), unter dem ich heute noch leide. Heute werte ich geistlich dieses Phase meines Dienstes im Geiste der Erfahrung des Jakob an der Furt zu Jabbok.
Schon nach drei Jahren musste ich die Pfarrei aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen, weil ich durch meine Erkrankung so eingeschränkt war, dass ich meinem Pfarrer keine große und verlässliche Hilfe mehr sein konnte.
Die Unerklärlichkeit Gottes auszuhalten hieß in diesem Fall für mich, sich zu engagieren, dabei persönlich die eigenen Grenzen vor Augen geführt zu bekommen … um dann einige Jahre später zu entdecken, dass dieser Weg ein guter für mich war, auch wenn ich es damals schwer annehmen konnte.
Der Tod (m)eines Kurskollegen
Wenige Jahre später erkrankte mein Kurskollege Kaplan Johannes Breining so schwer, dass er im Januar 2000 mit noch nicht mal 40 Jahren starb.
Seine Leidenszeit und auch sein viel zu früher Tod haben uns alle sehr zugesetzt. Mit wieviel Elan sind wir alle in unseren Dienst gegangen; wir hatten Vorstellungen darüber, wie unsere Zukunft mal aussehen könnte, wie wir z.B. als Pfarrer später mal eine eigene Pfarrei leiten würden?
Wir machten uns Gedanken über unsere Zukunft und auch die Zukunft unserer Kirche.
Doch der Tod von Johannes Breining hat mich mit der Nase darauf gestoßen, nicht zu weit nach vorne zu denken und zu planen, sondern vielmehr das „Hier und Jetzt“ in den Blick zu nehmen.
Das Lied: „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt…“ wurde da auf einmal sehr konkret und buchstäblich erfahrbar.
… und die Unerklärlichkeit Gottes auszuhalten heißt dann, trotz aller Visionen und Planungen damit klar zu kommen, dass Gottes Wege oftmals andere sind als jene, die unseren Vorstellungen entspringen.
Seelsorger im Strafvollzug

Anfang der 2000er Jahre war ich für sechs Jahre Seelsorger im Strafvollzug (Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen und Jugendarrestanstalt Essen-Werden).
Eher zufällig wurde ich dort Seelsorger, weil für die Eucharistiefeiern ein Priester fehlte, wurde ich angefragt, ob ich mir diesen Dienst vorstellen könnte. Ja, ich konnte, aber nur unter der Bedingung, dass ich nicht einmal in der Woche dort zur Zelebration ‚eingeflogen‘ komme und sonst nichts mit den Inhaftierten und den Mitarbeitenden zu tun habe. Ich wollte auch seelsorgliche Aufgaben übernehmen. Denn: es wäre für mich ein Widerspruch, Gottesdienste dort anzubieten, ohne an deren Alltag und Sorgen und Themen Anteil zu haben.
So bot ich Dienstag abends auch eine Gesprächsgruppe an. Dort trafen sich inhaftierte Männer, die wegen unterschiedlichen Delikten ‚einsaßen‘. In Gelsenkirchen hatten wir von einfachen Straftaten z.B. Diebstahl, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (Drogenhandel und -konsum), aber auch Betrug, Raub und Totschlag.
So komisch es klingen mag, aber ich bot diese Gruppe gerne an, denn es gab dort viele gute Gespräche und auch Begegnungen. In der Gruppe und auch in der Begleitung hatte ich auch Männer, die wegen eines schweren Gewaltverbrechens inhaftiert waren.
In meiner Arbeit durfte und musste ich oft in Abgründe menschlicher Existenz schauen. Ich habe erfahren, wie viele von ihnen für schlimme Taten verantwortlich waren. Ich habe aber auch erfahren, wie viele von ihnen selber Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind.
Ich lerne zu erkennen, dass der Mensch ein großes Geheimnis ist und dass wie niemals Menschen ganz kennenlernen oder gar durchschauen können. Ich habe erfahren, dass Menschen mit schwerer Schuld sich zugleich suchend und fragend auf den Weg gemacht haben. Ich habe gelernt, dass sich hinter einer harten Schale oft ein weicher Kern verbirgt. Wie sehr leiden inhaftierte Frauen und Männer, wenn ihre Beziehung unter der Haft Schaden nimmt, sie Angst davor haben, noch die Menschen ‚draußen‘ zu verlieren, die ihnen eigentlich am nächsten sein sollen.
Oft konnte ich erleben, dass wir sehr gute Begegnungen und Gespräche hatten, mit viel gegenseitigem Respekt und Achtung und auch mit viel Freude; und bei manchen entdeckte ich sehr viel Liebenswürdigkeit.
Das hat mich anfangs sehr überrascht und berührt.
Ich musste lernen, dass der Mensch nicht von Grund auf böse und schlecht ist und dass Menschen, die größte Schuld auf sich geladen haben, zugleich einen liebens-würdigen Kern besitzen können.
Anfangs hatte ich mich oft sehr unwohl gefühlt, wenn ich in eine Zelle zum Gespräch ging, wo jemand war, der schwere Verbrechen begangen hatte. Ja, natürlich hatte ich auch etwas Angst. Und wir wussten auch, dass in der Vergangenheit Seelsorger:innen schon mal als Geiseln genutzt wurden, damit Inhaftierte in die Freiheit kommen konnten.
Doch mit der Zeit, wurde diese Sorge immer kleiner; mit der zunehmenden Erfahrung wurde ich freier, von meiner berechtigten Sorge abzusehen und besser in die Begegnung gehen zu können.
Die Unbegreiflichkeit Gottes lag hier für mich darin, erkennen zu müssen, dass schwere Straftaten zwar das ganze Leben prägen werden, aber dass der Mensch dennoch nicht verworfen ist, von Gott.
Krankenhaus-Seelsorge

Seit Oktober 2010 arbeite ich als Krankenhaus-Seelsorger, in einem Krankenhaus der sogenannten „Maximalversorgung“. Dort gibt es drei somatische Kliniken (Urologie, Nephrologie und Lungen- und Bronchialheilkunde) sowie eine große psychiatische Klinik mit mittlerweile sechs Stationen, einer Tagesklinik sowie einer Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA).
Hier nehme ich das Thema unseres Weihespruches besonders deutlich wahr. Und vielleicht ist es auch gut, dass ich erst peu a peu und langsam steigernd in diesen Seelsorgebereich hineingekommen bin, gewappnet mit Erfahrungen der vorherigen knapp 16 Jahren.
Ich erlebe Patient:innen, die plötzlich, manchmal von heute auf morgen, mit schweren Erkrankungen konfrontiert werden, wo das Leben völlig aus den Fugen gerät, Zukunftspläne zerstört werden und schlimmstenfalls sogar Sorgen und Ängste um das eigene Leben den Alltag bestimmen. Ich erlebe psychiatrische Patient:innen, die wochen- oder gar monate- und jahrelang unter einer schweren psychischen Erkrankung leiden, zwischendurch mut- und hoffnungslos sind, aber sich immer wieder neu aufraffen. So oft höre ich Sätze wie: „Ich will mein altes Leben zurück!“
Das sind für mich Schreie der Hilflosigkeit und der Verzweifelung. Manche sind sogar überzeugt, dass das Ende ihres Lebens besser wäre, als so weiterzuleben.

Als Seelsorger versuche ich, die Menschen zu begleiten, damit sie ihre Situation besser ertragen oder bestensfalls sogar weiterhin einen Sinn in ihrem Leben sehen können, der ihnen die Kraft gibt, durch diese schwere Zeit zu gehen.
Aber zugleich spüre ich oft eine Sprachlosigkeit; Antworten aus meinem Munde wirken dann hohl und fern; Plattitüden verbieten sich und ich brauche selber Mut, um eingestehen zu können: auch ich habe keine Antworten.
Hier ist die Unbegreiflichkeit Gottes für mich am deutlichsten zu spüren.
Doch wenn ich dann zugleich auch eine Kraft in mir spüre, bei den Menschen zu bleiben, mit ihnen zu sein, dann spüre ich etwas vom Glauben, der da ist, obwohl ich zugleich die Unbegreiflichkeit Gottes spüre und auch aushalten kann.
Dass das nicht ohne Blessuren geht und es für mich eine Herausforderung und Zu-mutung ist, ist dabei natürlich selbstverständlich.