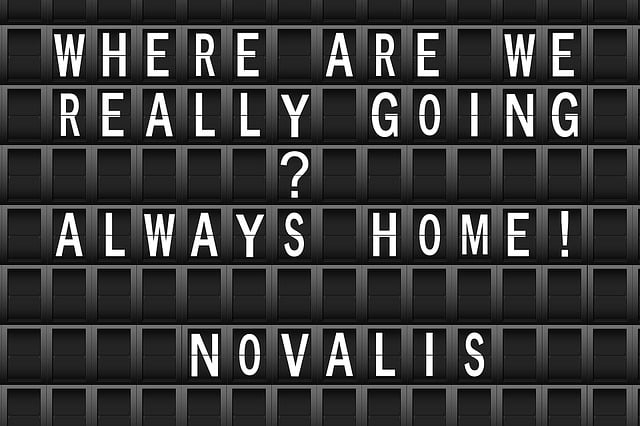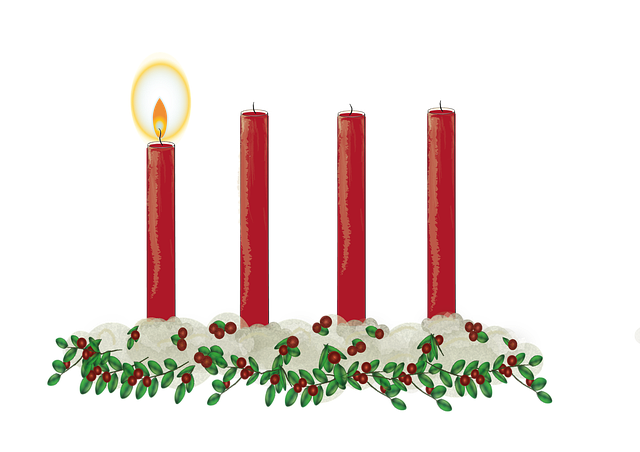Gaudete 2024

„Freut euch!“ sagt Paulus.
Das klingt schön, aber was, wenn man sich gar nicht danach fühlt?
Wenn man trauert, gemobbt wird, krank ist oder Weihnachten vor der Tür steht, man aber keine Freude empfinden kann?
Freude kann man doch nicht einfach befehlen oder erzwingen!
Was meint Paulus also damit?
Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Worte schreibt.
Er rechnet mit Folter oder sogar dem Tod.
Trotzdem ermutigt er die Menschen in Philippi: „Freut euch dennoch!“
Er spricht von einer tiefen inneren Haltung, nicht von oberflächlicher Fröhlichkeit.
Paulus meint: Seht nicht nur das Negative, bleibt gelassen und lasst euch nicht unterkriegen – trotz aller Schwierigkeiten.
Paulus sagt: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“
Diese Freude entsteht aus dem Vertrauen, dass wir zu Gott gehören und in ihm geborgen sind – wie ein Kind im Mutterleib.
Egal, was passiert, Gott ist bei uns.
Paulus erinnert uns: Ob wir leben oder sterben, wir gehören Gott.
Es gibt Menschen, die keine Freude mehr empfinden können.
Ihr Leben scheint nur aus Mühe und Sorgen zu bestehen.
Ihre Gesichter sind voller Falten, sie klagen und auch der Glaube wirkt wie eine Last.
Solchen Menschen zu sagen: „Freut euch!“ klingt sinnlos, aber genau sie brauchen diese Botschaft am meisten.
Andere Menschen strahlen Freude aus, auch wenn sie schwere Zeiten durchgemacht haben.
Diese Freude kommt von innen und zeigt sich in einer positiven Lebenseinstellung.
Genau diese Haltung meint Paulus.
Freude lässt sich nicht erzwingen, aber man kann sie lernen.
Freude ist wie ein Licht, das wir schützen müssen.
Viele Dinge können sie zerstören: Neid, Streit, Sorgen oder Unzufriedenheit.
Diese negativen Einflüsse sind wie ein Glas, das Licht erstickt, oder wie Steine, die auf die Flamme drücken.
Um Freude zu bewahren, können wir versuchen, folgende Impulse in unserem Leben umzusetzen:
- Lerne, dich selbst zu mögen und dir etwas zuzutrauen.
Wir sollten genießen können – wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Gut zu denken, zu handeln und andere gelten zu lassen, schenkt innere Zufriedenheit. - Sorgen gehören zum Leben, aber sie dürfen uns nicht beherrschen.
Denken wir an den großartigen Satz Jesu: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen.“ (Mt 11,28).
Wer seine Sorgen Gott hinhält, der lässt sie los und gibt damit der Freude Platz und Luft.
Wer Freude sich trägt, wird auch Frieden finden – mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Paulus verspricht: „Der Friede Christi, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren.“
Ich wünsche uns allen Mut und Kraft, diese Freude im Alltag zu leben. Sie hat die Macht, alles Schwere zu verbannen und das Wertvolle hervorzubringen. Vielleicht können wir so auch Weihnachten mit neuen Augen betrachten.