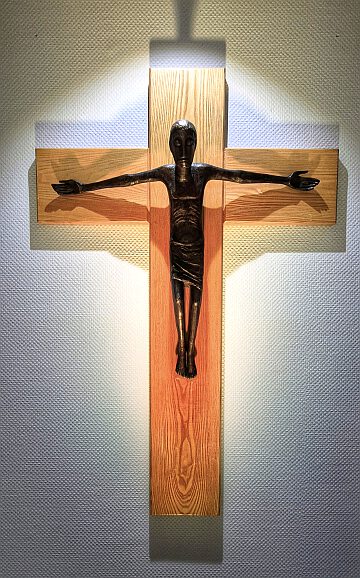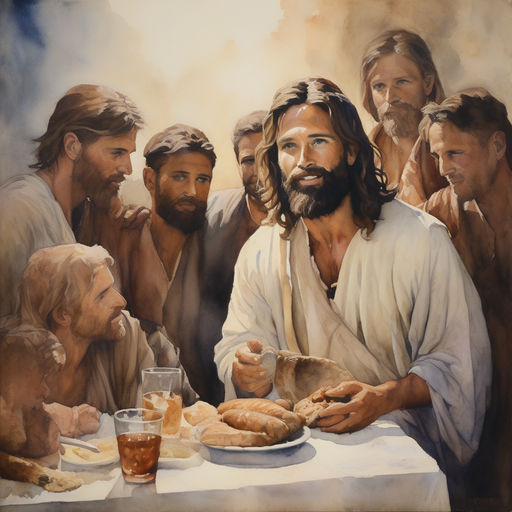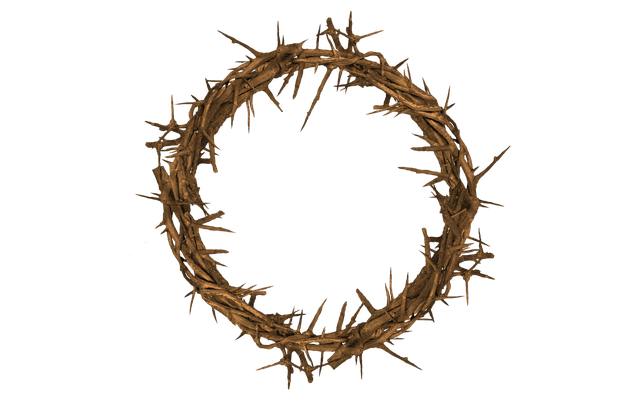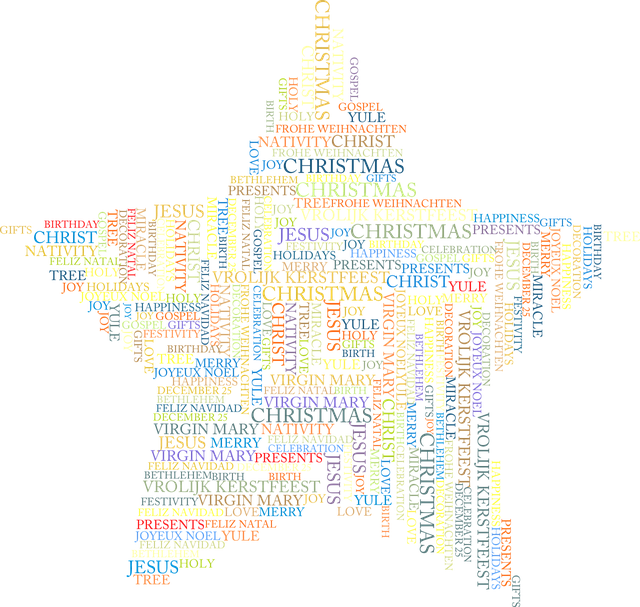Gaudete

Besinnliche Texte zum dritten Adventssonntag – Lesejahr A –
Wo die Wüste zu singen beginnt – Zur Lesung von Jesaja 35, 1-6b.10
Die Wüste atmet auf.
Dort, wo Staub die Sonne schluckte
und Stille schwer auf dem Horizont lag,
regt sich ein erstes Grün –
zart wie ein Flüstern,
das noch nicht weiß,
dass es ein Lied werden wird.
Vertrocknete Hände heben sich,
müde Knie richten sich auf.
Ein Mut wächst,
der längst vergessen schien.
Denn einer spricht: „Fürchtet euch nicht.“
Und dieses Wort geht wie Wasser
über dürre-rissige Erde.
Dann kommt es –
wie ein Licht, das niemand festhalten kann:
Augen öffnen sich,
Ohren hören wieder,
Zungen lösen sich
und finden den Ton der Freude.
Die Lahmen tanzen
und tragen die Hoffnung vor sich her
wie ein frisch entzündetes Feuer.

Die Steppe blüht,
als hätte sie auf diesen Moment gewartet
seit Anbeginn der Welt.
Und die Heimkehrenden gehen los –
auf einem Weg, der heilig genannt wird,
weil er zurückführt
in das Herz Gottes.
Kein Räuber hält sie auf,
kein Schatten legt sich ihnen in den Weg.
Freude holt sie ein,
und Schmerz und Seufzen
fallen von ihnen ab
wie altes Laub.
Am Ende ist nur noch Jubel,
der Himmel und Erde füllt –
und eine Wüste,
die endlich weiß,
dass auch sie
für die Blumen geschaffen ist.
© Gerd Wittka, Dezember 2025
Zum ‚Gaudete‘-Sonntag

Der dritte Advent trägt eine andere Farbe als die Tage zuvor:
ein zartes Rosa, das wir hier wirklich nur an der Farbe der Hintergrundbeleuchtung und an dieser rosafarbenen Kerze auf dem Altar erkennen und das
aufscheint wie das erste Licht des Morgens
am Rand einer langen Nacht, wie wir es auch am vergangenen Montag und Dienstag draußen erleben konnten.
„Gaudete – Freuet euch!“
So klingt es an diesem Sonntag im Advent –
und doch scheint die Welt ringsum es eher lauter zu übertönen:
volle Straßen, eilende Schritte,
Listen, Termine, Erwartungen;
als müssten wir Weihnachten herbeischaffen,
anstatt es zu empfangen.
Doch gerade hier,
mitten in der Geschäftigkeit,
beginnt die Freude,
von der die kirchliche Verkündigung heute spricht.
Es ist keine laute Freude,
keine, die übertönt oder überstrahlt.
Es ist die Freude der leisen Töne, die dort wächst,
wo wir still werden, wo wir uns Auszeiten nehmen,
zum Innehalten in diesen dunklen Tagen und wir darüber nachdenken, was es für uns heißen kann, dass Gott in Christus zu uns kommt und uns für seine frohe Botschaft begeistern möchte.
Diese leise Freude kann dort aufbrechen, wo ein Mensch für einen Augenblick in sich hinein horcht und die Worte meditiert:
„ER kommt.“
Der Verheißene,
der Retter,
der unser Herz berühren und bewegen wird
wie eine Hand, die sanft Türen öffnet.
„Machet die Tore weit“,
singt der Psalm,
„und die Türen in der Welt hoch, damit der König einziehe …“
Das ist keine praktische Bauanleitung, jetzt in der kalten Jahreszeit tatsächlich Türen und Tore zu öffnen.
Das wäre energetisch auch ziemlich widersinnig!
Und die wir diese Zeilen aus dem Psalm lesen und beten, wissen das selbstverständlich und verstehen darin die Bild-Sprache, die eine Einladung an unsere Seele ist:
• Schaffe Raum in dir und um dich herum, der dir Befreiung und Weite schenkt,
• Leere in deinem Leben, was vollgestopft ist.
• Verliere dich nicht in dem,was angeblich jetzt so wichtig ist.
Denn der König, oder besser: dein Erlöser, der kommen will,
tritt nicht ein
durch geschmückte Eingangshallen,
sondern durch die stille Kammer deines Herzens.
Er findet Wege,
wo du ihm Wege freigibst,
durch Ruhe,
durch Einkehr,
durch das stille Hoffen auf seine Wohltaten,
die er der „aufgescheuchten Seele schenken möchte, für das Heil, das er uns bereitet hat“, wie Dietrich Bonhoeffer in seinem bekannten Lied schrieb.
Gaudete –
Freut euch!
Weil die Freude nicht das Ziel,
sondern die Frucht des Wartens ist.
Weil Gott selbst im Kommen begriffen ist,
auch wenn wir es noch nicht sehen.
Weil ein leises, unscheinbares Licht
bereits den Horizont berührt
und uns zuflüstert:
Die Nähe Gottes wächst –
und mit ihr
die wahre Freude.