Kluge Lebensführung
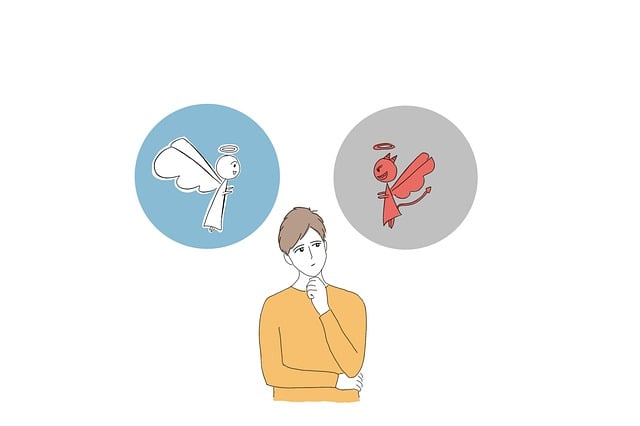
oder: Wie wir Gottes Willen in diesen Zeiten begreifen können…
Impuls zum 20. Sonntag im Jahreskreis – Lesejahr B – 2024
Textgrundlage: Epheser-Brief 5, 15-20
„… die Zeiten sind böse…“
Was bedeutet ‚böse? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten.
Aber es gibt Anzeichen dafür, was mit ‚böse‘ gemeint sein könnte: alles, was uns von Gott oder seinem Willen entfernt, oder was uns von uns selbst und anderen Menschen trennt.

Das können zum Beispiel schlechte Nachrichten sein, die uns traurig, ängstlich oder hoffnungslos machen.
Oder Menschen und Situationen, die uns belasten: schwierige Lebensbedingungen, große Herausforderungen, oder der Druck, dem Mainstream zu folgen (das, was gerade „in“ ist).
Sicherlich sind auch die Zeiten, in denen wir leben, herausfordernd.
Der zunehmende Hass gegen andere, gegen Menschen aus fremden Ländern, gegen Menschen mit anderen Religionen oder Ansichten, oder gegen diejenigen, die uns angeblich etwas wegnehmen könnten, ist ein deutliches Zeichen dafür.
Schwierig wird es auch, wenn dieser Hass in echte Gewalt umschlägt, sei es in unserem Land, in Europa oder weltweit.
Das erinnert uns an schlimme Zeiten in der Vergangenheit.
Ich frage mich manchmal: Was könnten uns die Menschen, die solche Zeiten bereits erlebt haben und heute um die 90 Jahre alt sind, dazu sagen?
Was würden sie uns raten, wie man damit umgehen kann?
„Lasst euch nicht vom Wein berauschen!“

Wir wissen, wie zu viel Wein oder Alkohol wirkt. Er trübt unsere Sinne und nimmt uns die Fähigkeit, Dinge klar und sachlich zu sehen.
Manche greifen zu Alkohol oder Drogen, um sich von den Problemen um sie herum abzulenken oder sich abzuschotten.
Solche Mittel machen manches vordergründig erträglicher, aber wenn der Rausch vorbei ist, holt die Realität uns umso härter ein – oft mit einem unangenehmen Kater.
Eine klare und vernünftige Sicht auf die Dinge kann uns helfen, Herausforderungen besser zu bewältigen.
Der Versuch, sich weder von äußeren Einflüssen manipulieren zu lassen noch sich selbst zu täuschen – sei es durch Verhaltensweisen, die die Realität verdrängen, oder durch eine „rosarote Brille“ – kann ein stabiles Fundament für den geistlichen Umgang mit den Herausforderungen des Lebens sein.
Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie Stille uns helfen kann, uns selbst und unseren göttlichen Ursprung nachzuspüren und zu finden.
Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte des Mönchs, der von Gästen gefragt wurde, welchen Nutzen er in der Stille, Ruhe und Einsamkeit sieht. Anhand eines Brunnens und des Zustands seines Wassers erklärte er, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn wir zur Ruhe kommen.
Heute wollen wir uns den äußeren Bedingungen widmen, die uns helfen, zur Ruhe zu finden und so mit unserem wahren Selbst in Kontakt zu kommen.

Am Sonntagmorgen las ich eine Einladung von Bruder Jan zu seinem geistlichen Podcast „barfuß und wild“. In dieser Folge ging es um das Urvertrauen.
Urvertrauen ist entscheidend, damit wir – wie Paulus uns nahelegt – die Zeit sinnvoll nutzen, klug handeln und den Willen Gottes erkennen.
Urvertrauen gibt uns festen Boden unter den Füßen, wenn vieles um uns herum ins Wanken gerät. Es verleiht uns emotionale und geistige Stabilität.

Der Inhalt zur Einladung von Bruder Jan lässt sich wie folgt zusammen fassen:
Urvertrauen wird oft als etwas angesehen, das in den ersten Lebensjahren entsteht und uns durch Krisen trägt. Es wird diskutiert, ob Urvertrauen später wiederhergestellt werden kann, wenn es früh gestört wurde.
Während einige meinen, dass es nicht möglich ist, betont eine geistliche Haltung, dass Urvertrauen in ihrer ganzen Fülle immer schon vorhanden war.
Dieses Urvertrauen ist Teil des göttlichen Wesens.
„Wir stammen aus dem Urvertrauen.
Wir brauchen das Urvertrauen also gar nicht zu »machen« oder »herzustellen« oder zu »heilen« und können das auch gar nicht.“
(Bruder Jan Frerichs, Quelle: https://www.barfuss-und-wild.de/)
Dieses Urvertrauen werde im Laufe des Lebens verschüttet und damit erschüttert, damit wir es auf einer tieferen Ebene neu entdecken können. Das wahre Abenteuer bestehe darin, sich immer wieder an dieses Urvertrauen zu erinnern.

Bruder Jan glaubt, dass Urvertrauen immer in uns vorhanden sei, da Gott selbst dieses ewige Urvertrauen sei, auf dem alles basiert.
Dieses große Vertrauen Gottes in uns Menschen zeigt sich darin, dass er uns überhaupt erst erschaffen hat. Angesichts der Krisen unserer Zeit ist es beeindruckend, wie grenzenlos dieses göttliche Vertrauen sein muss.
Paulus lädt uns heute dazu ein, regelmäßig innezuhalten und uns zu fragen, wie wir unsere begrenzte Zeit sinnvoll nutzen. Dabei geht es ihm nicht nur darum, Probleme zu lösen, sondern vor allem darum, in Verbindung mit Gott zu bleiben. Bruder Jan würde sagen, es geht darum, unser Urvertrauen wiederzufinden und uns daran zu erinnern.
Für Paulus gehört dazu auch der Gottesdienst, das Singen von Psalmen und Liedern, sowie Dank und Lob an Gott.

Die Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens werden nicht gelöst oder kleiner, wenn wir sie durch Aktionismus oder Ablenkung verdrängen.
Aber wir haben eine bessere Chance, sie zu bewältigen, wenn wir uns in Ruhe, Stille und Gebet darauf besinnen, was wirklich in unserem Leben trägt und uns hilft, ein erfülltes Leben zu führen.
© Gerd Wittka







