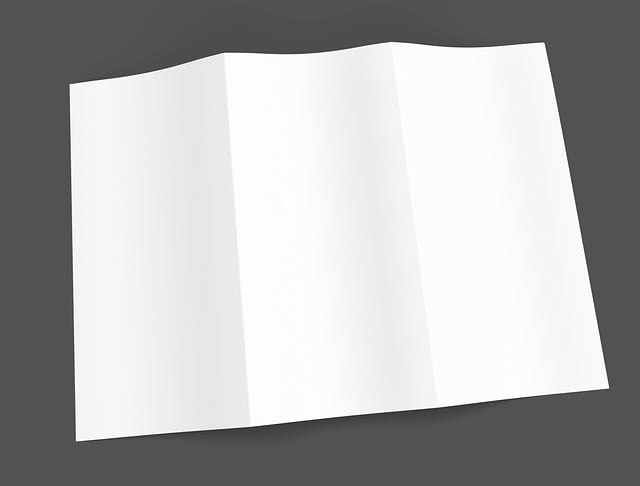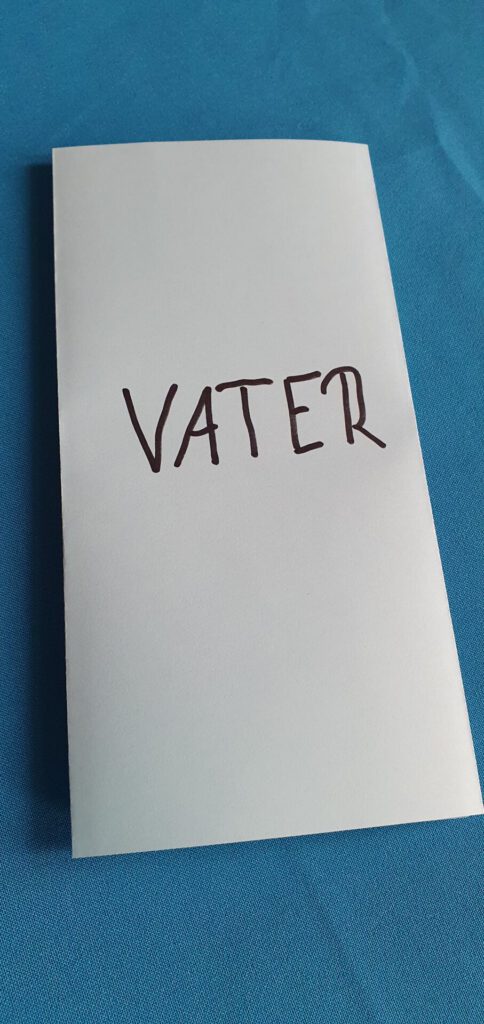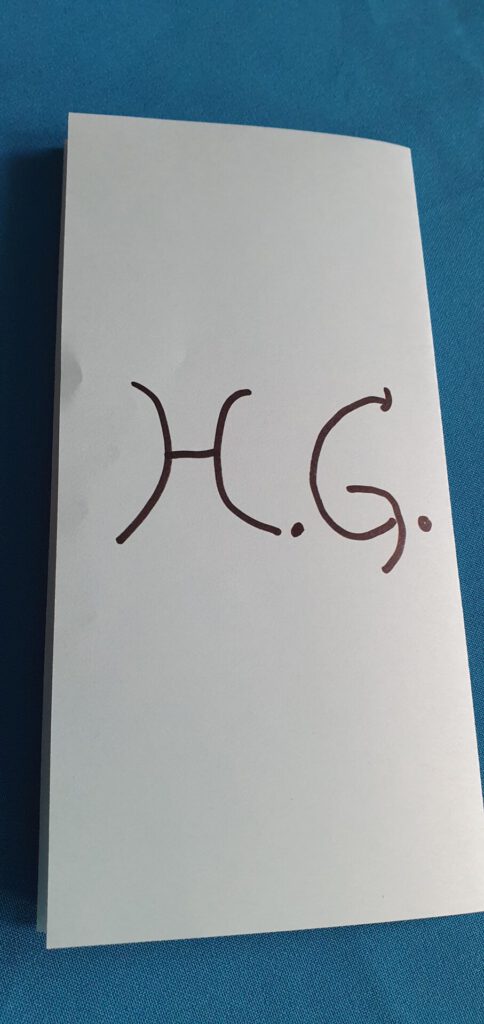Pfingsten 2025

Heute feiern wir Pfingsten – den Tag, an dem Gottes Heiliger Geist uns neu erfüllt.
Wir erinnern uns an die Jünger im oberen Raum von Jerusalem: Da war plötzlich ein Brausen wie vom Wind, und Flammenzungen leuchteten über ihren Köpfen. Aus Unsicherheit und Zweifel wurden sie mutige Erzähler, die in unterschiedlichen Sprachen von Gottes großen Taten berichten (Apg 2,1–4).
Doch was kann das heute für uns bedeuten?
Wie trägt dieser Geist bei uns persönlich, unseren Gemeinden und in unserem Alltag dazu bei, dass wir lebendiger und freudiger werden?
Muss der Heilige Geist in vertrauten Ritualen bleiben – oder möchte er uns gerade herauslocken und uns ermutigen, kleine Abenteuer im Glauben zu wagen?
Die Gänse auf dem Hof (nach Kierkegaard)
Sören Kierkegaard erzählt in einem Gleichnis von Gänsen, die sonntags gespannt den Worten eines erfahrenen Gänserichs lauschen, der von früheren Flügen berichtet.
Doch die Gänse bleiben lieber auf dem sicheren Hof, weil dort das Futter reichlich und das Leben bequem ist.
Dieses Gleichnis lädt uns liebevoll ein, darüber nachzudenken, ob wir uns manchmal in wohlbekannten Abläufen einrichten, ohne wirklich aufzubrechen:
• Wir treffen uns zum Gottesdienst, hören inspirierende Worte, danken Gott – und gehen danach in den Alltag zurück, ohne größere Veränderungen vorzunehmen.
• Wir bewundern Menschen wie Paulus oder Stephanus für ihren Mut, finden aber häufig nicht den Impuls, selbst den nächsten Schritt zu wagen.
An Pfingsten dürfen wir das mit einem Augenzwinkern eingestehen: Der Heilige Geist ist kein Ausstellungsstück, das wir nur bestaunen können.
Er ist eher wie ein frischer Wind, der uns behutsam ermutigen will, den sicheren Hafen zu verlassen und uns auf Neues einzulassen.
Denn:
„Gottes Heiliger Geist gehört in Abenteurerhand!“
Dieses Motto klingt prägnant und herausfordernd zugleich.
Es erinnert uns daran, dass wir nicht zum Stillstand bestimmt sind, sondern zum Fliegen – zum Entdecken neuer Horizonte in unserem Glaubensleben.
Pfingsten schenkt uns den Heiligen Geist, damit wir mutig leben und Gottes Liebe weitergeben können:
Wie die Jünger damals dürfen auch wir peu à peu unsere Komfortzone verlassen.
Natürlich können wir weiterhin über Glaubensfragen nachdenken und diskutieren. Doch wenn unser Denken und Wissen nicht in Taten mündet, verschenken wir die Chance, den Heiligen Geist wirklich wirken zu lassen.
In ihrem Gedicht ‚Aus der Traum‘ beschreibt Marianne Willemsen, wie der Heilige Geist den Trugschluss von einer sorgenfreien, gleichförmigen Existenz durchbricht.
Er weckt die im Verborgenen schlummernde Sehnsucht, befreit sie aus dem gelangweilten „Dornröschenschlaf“ und schenkt Mut und Kraft, Ängste zu teilen und neue Herausforderungen anzunehmen.
Quelle: Der Geist des Herrn erfüllt das All | Pfarrbriefservice.de
Diese Zeilen weisen mit klaren Worten darauf hin:
Pfingsten möchte uns behutsam aus dem Dornröschenschlaf holen, damit wir den Mut finden, unsere Sehnsucht auszudrücken und Neues zu wagen.
Es ist keine Aufforderung zum Perfektionieren, sondern eine Einladung, in unserer eigenen Kraft zu stehen und uns gegenseitig zu ermutigen.
„Gottes Heiliger Geist gehört in Abenteurerhand!“
Dieses Bild ist eine Einladung, den Glauben aktiv und mit offenem Herzen zu leben. Vielleicht ergibt sich daraus:
1. Spontane Gespräche zulassen
Wenn wir im Alltag aufeinander zugehen – sei es im Café, in der Bahn oder am Arbeitsplatz – dürfen wir ganz selbstverständlich von unserer Hoffnung erzählen. Dabei genügt ein offenherziges Gespräch, ohne Druck oder Erwartung.
2. Gemeinsam Nachhaltigkeit gestalten
Junge Menschen organisieren eine Kleidertausch-Aktion und zeigen, wie bereichernd nachhaltiger Konsum sein kann. So entsteht Gemeinschaft und Bewusstsein für Gottes Schöpfung.
3. Eigene Gaben entdecken und teilen
Jede Begabung ist wertvoll – sei es Musik, Handwerk, Sprache, Organisation oder Zuwendung. Wenn wir unsere Talente bewusst einsetzen, wird unsere Gemeinschaft bunter und reicher.
4. Fehlerfreundlich unterwegs sein
Neues auszuprobieren bedeutet manchmal, dass nicht alles glatt läuft. Aber gerade dann können wir aus unseren Erfahrungen lernen und miteinander wachsen. Glaube ist kein perfektes Programm, sondern eine Reise, die wir gemeinsam gestalten.
5. Klare Kante zeigen
Der Heilige Geist befähigt uns heute, klare Positionen einzunehmen. Das heißt, wir können ganz einfach unsere Meinung äußern, wenn wir einem Standpunkt nicht zustimmen, zum Beispiel indem wir sagen: „Ich teile deine Meinung nicht!“.
Ebenso sollten wir Missstände ansprechen, wenn etwas aus unserer Sicht falsch läuft.
Persönlich habe ich erfahren, dass mein Eintreten andere ermutigt.
Andererseits kann mich das Engagement von Mitmenschen gegen Ungerechtigkeit anspornen, diese aktiv zu unterstützen – in Wort und Tat. So holt uns der Heilige Geist aus unserer Komfortzone und motiviert uns, für Wahrheit und Gerechtigkeit einzustehen.
Ein Beispiel, wie es gehen kann, zeigt das Video unten.
6. Dem Geist vertrauen
Wir sind nicht allein: Der Heilige Geist, der damals auf die Jünger herabkam, begleitet uns heute genauso.
Er schenkt uns Mut und Mitgefühl – auch wenn wir uns innerlich unsicher fühlen.

Wenn wir diese Einladungen annehmen, bleibt Pfingsten nicht nur ein einmaliger Tag im Kalender, sondern wird zum täglichen Licht in unserem Leben.
Dann dürfen wir, getragen vom Geist Gottes, kleine und große Abenteuer wagen und miteinander erleben, wie wir wirklich fliegen können – statt am Boden zu verharren.
Ich würde gerne mit Ihnen und mit vielen anderen in unserer Kirche wieder fliegen!