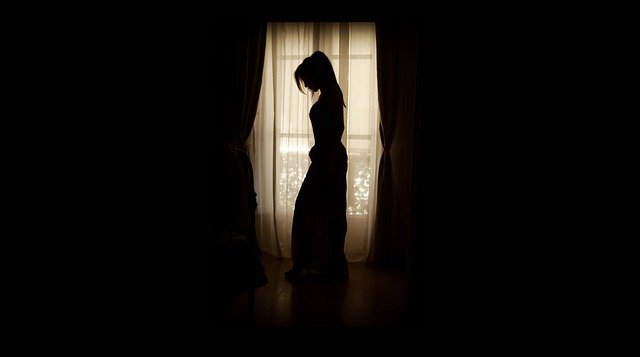Freiheit – trotz Reduktion

In der Krise die Freiheit erkennen
Ja, es ist mal wieder so: diese Gedanken erwachsen aus der gegenwärtigen Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Krise.
Manche können das Thema schon nicht mehr hören, und auch ich wäre froh, wenn wir schon alles überstanden hätten. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir noch mitten drin sind.
Wen wundert es dann also, dass die Krise – zumindest mich – gedanklich immer wieder beschäftigt. Oft ist in den vergangenen Wochen davon die Rede, dass diese Krise „wie ein Brennglas“ wirkt auf viele Themen und Herausforderungen, die sonst gar nicht so in den Blick geraten wären.
Mein großes Thema: die Freiheit! …
Wenn ich über diese Krise nachdenke, dann komme ich immer wieder auch auf das Thema „Freiheit“ zurück.
Und ich finde, das ist auch gar nicht verwunderlich.
Denn: wesentlich für diese Corona-Pandemie ist, dass folgende Wörter zwangsläufig mit ihr in Verbindung gebracht werden:
- Reduktion
- Lockdown
- Abstand
- Schließungen
- Herunterfahren
- …
All diese Wörter werden mit Begrenzungen, Eingrenzungen, Beschneidungen in Verbindung gebracht. Viele sagen auch: die Corona-Pandemie schränkt unsere Freiheiten ein! – Und das stimmt! Wer könnte dem widersprechen?!
Die Logik dieser Pandemie ist, dass durch Einschränkungen von (äußeren) Freiheiten wir ein wesentliches Werkzeug an der Hand haben, um der Pandemie etwas entgegen zu setzen.
Die zwei Seiten einer Medaille
Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne das Bild von den „zwei Seiten einer Medaille“ verwende.
Auch in diesem Zusammenhang halte ich es für hilfreich, dieses Bild einzusetzen, denn:
Einerseits erleben wir diese Zeit als begrenzte und eingeschränkte Zeit; Freiheiten, die für uns so selbstverständlich sind (und auch wieder werden müssen), haben wir im Moment nicht.
Um in der Balance bleiben zu können, um Kraft und Ressourcen finden zu können, diese einschneidenden Maßnahmen körperlich und psychisch gut überstehen zu können, braucht es einen Gegenpol, die andere Seite der Medaille, die wir anschauen sollten.
Ermöglichung
Ich möchte für die andere Seite den Begriff „Ermöglichung“ nennen!
Mein früherer Kollege, Mark Bothe, stellte sich, als er seine Stelle in unserer Pfarrei antrat, mit dem Hinweis vor, er wolle „Ermöglicher“ sein.
Mit dieser Formulierung hatte er meine ganze Aufmerksamkeit. (Vielen Dank für diesen Gedanken, Mark, den du bei mir eingepflanzt hast!)
Denn wenn wir unsere Lebenssituation bedenken, wenn wir Wege aus einer Krise finden wollen, wenn wir neue Wege gehen müssen, weil die alten Wege in eine Sackgasse oder in den Abgrund führen, dann kommen wir an einer zentralen Frage nicht vorbei:
Welche Möglichkeiten haben wir (sonst noch)?
Gerade in Zeiten, wo wir unser Leben eingeschränkt erfahren (das gilt auch in persönlichen Lebensphasen, die von Krankheit oder anderen Einschränkungen wie Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not, etc.), kann es hilfreich und notwendig sein, nach einem Ausgleich zu suchen: der anderen Seite der Medaille.
Manche mögen es auch mit dem Bild von Ying&Yang vergleichen wollen:
zur inneren Harmonie kann man nur finden, wenn man buchstäblich „ausgeglichen“ ist und mein Leben wieder eine Balance gefunden hat.
Und diesen inneren und äußeren Ausgleich finden wir nur, wenn wir versuchen, die Möglichkeiten zu finden, die in einer Krise liegen.
[Damit möchte ich keineswegs irgendeine Relativierung vornehmen. Ich bin mir sehr bewusst, dass Krisen oft auch mit persönlichem Leiden und persönlichen oder sozialen Notlagen einher gehen. Mir geht es nicht darum, diese Not und diese Leiden abzutun oder zu verharmlosen. Ich suche nur einen Weg, wie man mit dieser Not, mit diesem Leid, mit dieser Eingrenzung besser leben kann. Wenn ich das alles schon nicht verhindern kann, dann gibt es für mich persönlich nur die eine Hoffnung: damit zu leben ohne daran zu zerbrechen.]
In Krisenzeiten Möglichkeiten und Freiheiten zu entdecken, die trotz allem (noch) vorhanden sind, erscheint mir eine wichtige Strategie zu sein, um gut und wohlbehalten solche Phasen des Lebens zu überwinden.
Hier kommt wieder der Gedanke meines Kollegen ins Spiel, der seine Rolle auch darin sieht „Ermöglicher“ zu sein.
Wer dann darüber nachdenkt, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wird zwangsläufig auch an den Punkt kommen, wo sie/er über die persönliche Freiheit nachdenken wird. Denn: was mir möglich ist, was ich noch tun kann, beantwortet sich wesentlich auch im Zusammenhang mit der Frage: welche Freiheiten habe ich?
Glaube der befreiend sein muss: Christ*in-Sein
Im Galaterbrief finde ich folgende Verse:
„…Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen!…“ (Gal 5,1)
Was Paulus hier an die Galater schreibt, ist nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen. Er hat diesen Glauben übernommen, weil er die Botschaft Christi ernst genommen hat und er musste erkennen, dass Christsein ohne Freiheit nicht möglich ist.
Die Botschaft Jesu Christi ist wesentlich eine Botschaft der Befreiung und damit eine Botschaft der Freiheit.
Perspektive in der Krise

Die Fähigkeit, seine Möglichkeiten gerade auch in der Krise zu entdecken, kann ein wesentlicher Schlüssel dafür sein, wie gut wir durch die Krise kommen. Die Erkenntnis, trotz aller Einschränkungen die eigene konkrete Freiheit zu entdecken, eröffnet in der Krise die Chance, auf dem Weg zu bleiben, handlungsfähig zu sein und somit aktiv die Krise gestalten zu können.
Wer also Wege aus der Krise entwickeln möchte, braucht einen tiefen Glauben und die feste Zuversicht, dass wir die Freiheit haben, immer wieder nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, die uns die „Leiden der gegenwärtigen Zeit“ erträglicher machen.
Denn: wir sollen zu jeder Zeit „…von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes….“, wie es Paulus in seinem Römerbrief zum Ausdruck bringt. (vgl. Röm 8,21).
Die eigenen Möglichkeiten zu entdecken geht nur, wenn wir verstanden haben und ernst nehmen, dass wir als Menschen zur Freiheit berufen sind.
Christ*innen und die Kirchen könnten dazu einen wichtigen Beitrag leisten!
[Selbstkritisch ließe sich zu der Rolle der Christ*innen und Kirchen in dieser Krisenzeit noch einiges sagen. Aber das wäre eines eigenen Artikels wert.]
Doch wenn jede*r Einzelne*r von uns, seine Möglichkeiten entdeckt, auch die Freiheit, sich für etwas einzusetzen, „Ermöglicher*in“ zu sein, dann bin persönlich zuversichtlich, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise und durch andere Krisen kommen werden.
Und? Wie denkst du darüber? – Hinterlasse gerne einen Kommentar zu meinen Gedanken!