Werde wesentlich …
Ansprache zum Impuls: „… macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle …“ (Joh 2, 13–22)

Wunderbar passt das heutige Evangelium zu dem Wochenende, an dem in unseren Pfarreien die Wahlen zum Pfarrgemeinderat und zum Kirchenvorstand stattfinden.
Diese Szene aus dem Johannesevangelium ist eine der eindrücklichsten im ganzen Neuen Testament: Jesus, der mit Nachdruck die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertreibt. Es ist eine heftige, fast verstörende Geste – und zugleich eine zutiefst prophetische. Sie rüttelt auf, sie stellt in Frage, sie legt den Finger in eine Wunde.
Denn das, was damals geschah, ist auch heute aktuell: Das Haus Gottes wird kommerzialisiert. Orte, die eigentlich dazu bestimmt sind, Innerlichkeit und Gottesbezug zu fördern, werden nicht selten zum Schauplatz geschäftiger Betriebsamkeit. Da werden Devotionalien, die oft kaum mehr als billiger Ramsch sind, zu überhöhten Preisen verkauft. Und noch größer ist der Markt der Esoterik und des vermeintlich Spirituellen – ein riesiger Markt der Sehnsucht, auf dem fragwürdige Produkte und Praktiken Hoffnung und Heil versprechen. Die Sehnsucht nach dem Heiligen wird kommerzialisiert.
Stattdessen müssten wir uns fragen, wie wir unsere Gottesdienste und Kirchen wieder mehr zu Orten der Gotteserfahrung, zu geistlichen, zu wahrhaft ‚heiligen‘ Orten werden lassen können.
Denn Jesus sagt: „Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle!“
Und dieses Wort lässt sich nicht nur auf Kirchengebäude anwenden.
Paulus erinnert uns: „Euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes.“ (vgl. 1 Kor 6, 19)
Das bedeutet: Auch wir selbst sind Wohnstätten Gottes.
Und so dürfen wir uns fragen:
Wo haben wir aus uns selbst eine Räuberhöhle gemacht?
Wo ist das Heilige, das Spirituelle, das Gebet, die Andacht an den Rand gedrängt worden?
Wo lassen wir Gott keinen Raum mehr, Wohnung in uns zu nehmen?
In der Orthodoxie gibt es ein wunderbares Gebet an den Heiligen Geist, das genau das in den Blick nimmt:
„Himmlischer König,
Tröster, Geist der Wahrheit,
Allgegenwärtiger und alles Erfüllender,
Schatz der Güter und Lebenspender,
komm und nimm Wohnung in uns,
reinige uns von aller Befleckung
und errette, Gütiger, unsere Seelen.“
Was für ein starkes und zugleich inniges Gebet. Es erinnert uns daran, dass der Heilige Geist Raum braucht – in uns, in unseren Gemeinden, in unserer Kirche.
Doch wie oft scheint es, als wären andere Dinge wichtiger: Geld, Gebäude, Strukturen.
Wir erleben massive Umbrüche in unseren Kirchen – vielerorts wird beraten, debattiert, gerungen:
• Wie geht es weiter?
• Was ist zu erhalten?
• Was muss sich ändern? Und wenn man genau hinschaut, dann stehen oft zuerst Finanzen und Immobilien auf der Tagesordnung.
Erst viel später kommen Themen wie Seelsorge, Glaubensvertiefung, Gebet, Caritas, das lebendige Zeugnis unseres Glaubens.
Aber christliches Leben wird auf den Kopf gestellt, wenn wir zuerst über Geld, Steine und Strukturen sprechen – und nicht zuerst über den Glauben.
Denn dieser Glaube ist es, der uns trägt, der uns Sinn und Halt gibt in all den Fragen und Herausforderungen des Lebens.
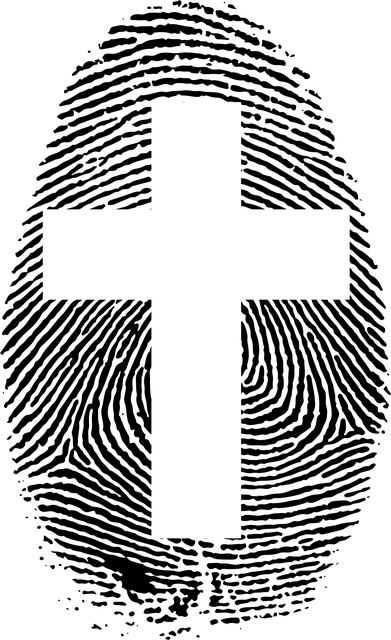
Dieser Glaube, der uns im wahrsten Sinn des Wortes beseelt, sollte auch in der Gestaltung und Atmosphäre unserer Gottesdienste spürbar werden.
Kirchen sind nicht allein Erfahrungsräume und Kulissen für spirituelle Erlebnisse.
Doch gerade Kirchen und gottesdienstliche Räume, wie unsere Kapelle hier, dürfen nie aufhören, Orte zu sein, an denen die Begegnung mit Gott möglich bleibt – Orte lebendiger Gottesbeziehung, die Herz und Seele berühren.
Vor einigen Wochen hatte ich ein sehr interessantes Gespräch.
Da erzählte mir jemand, dass er regelmäßig Gottesdienste ganz unterschiedlicher Konfessionen und Gemeinden besucht – immer auf der Suche nach einem Ort, an dem seine Seele zur Ruhe kommen kann.
Ein Ort, an dem er geistliche Gemeinschaft erfährt und sich in vertraute Rituale fallen lassen kann; eine Atmosphäre, die ihm hilft, innerlich aufzutanken, geistlich zu werden, spirituell zu sein.
Er sucht nach einer Quelle, aus der er schöpfen kann – um dann gestärkt und neu gesammelt wieder in den Alltag zurückzukehren.
Denn, auch das gehört dazu:
Unser praktizierte Glaube öffnet Fenster und Türen, damit wir nicht in uns selbst kreisen, sondern hinausgehen in die Welt – als ‚Salz der Erde‘ und ‚Licht der Welt‘.
Unsere Welt dürstet nach Sinn, nach Tiefe, nach Orientierung – nach etwas, das über all die Krisen, Konflikte und Veränderungen hinausweist. Nach einer Hoffnung, die trägt und die, wie der Morgenstern uns den Weg in der Dunkelheit zeigt.
Am Weihetag der Lateranbasilika, der „Mutter aller Kirchen Roms“, dürfen wir uns neu fragen, was Kirche heute wirklich ausmacht?!
Denn darum geht es in unserem Glauben: nicht um den Erhalt von toten Steinen oder vergänglichem Geld, sondern um die lebendige Beziehung zu Gott, um das Hören auf seine befreiende Botschaft, damit die Kraft des Heiligen Geistes in uns und unter uns wirken kann, die uns verwandelt – und die Welt mit uns.
Die deutlichen Worte der Tempelreinigung sind keine Drohung, sondern eine Einladung – eine Einladung zur Erneuerung.
Die Zukunft unserer Kirche hängt daran, worauf wir unser Fundament bauen:
auf toten Stein – oder auf den lebendigen Glauben,
auf vergängliches Geld – oder auf die unvergängliche Beziehung zu Gott im Heiligen Geist?!









