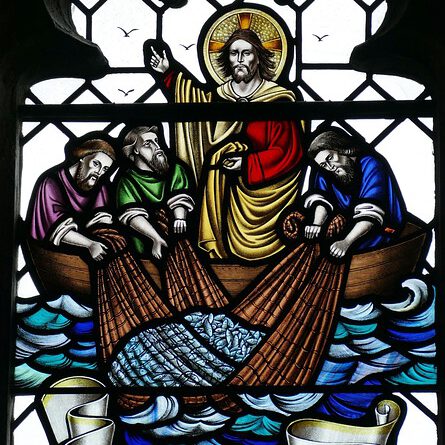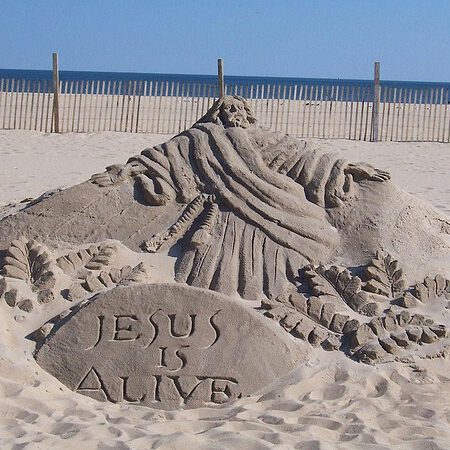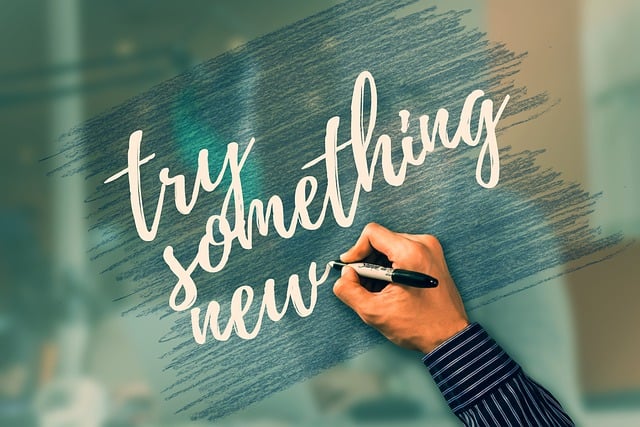„Wen der Herr liebt, …“
Über eine echt problematische Lesung am 21. Sonntag im Lesejahr C
Schriftlesung: Hebräer 12,4-13 | Einheitsübersetzung 2016 :: ERF Bibleserver
Ich erinnere mich:
Als ich als Kind einmal meine Oma besuchte, fand ich in ihrem Schrank einen Stock mit Lederriemen.
Ich fragte sie, was das ist. Sie sagte: „Eine Kopppeitsche.“ Damit hatte mein Opa früher seine Kinder geschlagen.

Da wurde ich traurig. Auch mein Vater war als Kind so behandelt worden. Anfangs, als Familienvater, hielt er es auch für normal, uns Söhne durch Schläge zu erziehen und zu bestrafen.
Dabei war unser Vater war eigentlich liebevoll. Er war selbständiger Handwerker, aber sonntags nahm er sich Zeit für uns Kinder, da war er für uns da.
Wir liebten ihn sehr, vielleicht auch deshalb, weil er bald von solchen ’schlagkräftigen Erziehungsmethoden‘ Abstand nahm. Meine Eltern lernten gemeinsam: Liebe hat nichts mit Gewalt zu tun.
Ich finde diese Entwicklung, die sie gemeinsam zugelassen haben, großartig!

Und obwohl sie uns später nicht mit körperlicher Gewalt erzogen, sind wir, ihre sechs Söhne, alle gut durchs Leben gegangen.
Wer hat denn nun Recht: die heutige Lesung oder meine Eltern mit ihrem Erziehungsstil?!
Gerade wegen dieser persönlichen Erfahrung empfinde ich die heutige Bibellesung als schwierig und äußerst problematisch.
Sie ist eine Herausforderung, darüber zu predigen – und trotzdem will ich mich ihr stellen.
Denn ich finde darin einen wichtigen Gedanken, der es wert ist, im Mittelpunkt zu stehen.
Um das zu verstehen, müssen wir uns die Absicht des Apostels Paulus anschauen.
Sein Brief sollte den Glauben von verunsicherten Christen stärken, die Verfolgung, Zweifel und Enttäuschungen erlebt hatten. Paulus wollte ihnen Mut machen, damit sie im Alltag mit ihrem Glauben standhalten konnten.

Er spricht von „Züchtigung“; wir kennen das damit verwandte Wort „Zucht“, die eine
gezielte und geplante Erziehung und Prägung meint, z.B. in der Pflanzen- oder Tierzucht.
Dafür benutzte Paulus aber Bilder aus seiner Zeit – Bilder, die uns heute fremd erscheinen.
Denn diese Bilder greifen eine zentrale Frage auf, die schon im Alten Testament eine große Rolle spielte:
„Welchen Sinn hat Leid?“
Die damalige Antwort lautete: Leid kann den Menschen erziehen.
Für mich ist das ein sehr schwer erträglicher Gedanke – zumindest auf den ersten Blick.
Doch wenn Menschen leiden oder mit anderen mitleiden, passiert tatsächlich etwas mit ihnen.
Im besten Fall setzen sie sich mit dem Leid auseinander und suchen Wege, damit umzugehen – allein oder mit Hilfe von Familie, Freunden, Therapeuten, Seelsorgern und anderen.
Dabei kann ein tieferes Verständnis für das eigene Leben entstehen, vielleicht sogar ein neuer Blick auf den Sinn des eigenen Lebens.
Auch ich habe so etwas erlebt.
Mein Vater starb mit 45 Jahren, ich war damals 17.
Als er krank wurde, war ich gerade 10 Jahre alt.
Er hatte einen Hirntumor und litt fast acht Jahre lang daran. Das war für ihn und unsere ganze Familie eine schwere Zeit – auch finanziell. Aber wir hielten zusammen.
Als Kinder begleiteten wir unseren Vater auf Spaziergängen, betreuten ihn in unserer Freizeit in gewisser Weise, später halfen wir bei seiner Pflege zu Hause.
Das waren Erfahrungen, die eigentlich kein Kind machen sollte. Aber wir wurden nicht davor bewahrt.
Und gerade in dieser schweren Zeit haben wir eine besondere Nähe und Verbundenheit in unserer Familie erlebt, die es ohne das Leid vielleicht nie gegeben hätte.
Diese Erlebnisse haben mich sehr geprägt. Sie machten mich sensibel für den Umgang mit Leid – bei mir selbst und bei anderen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich später Seelsorger geworden bin.
Natürlich hatte diese Zeit auch ihren Preis: Unsere Jugend war nicht unbeschwert.
Ich war noch nicht einmal 18 Jahre alt, als ich schon meine erste Ausbildung abgeschlossen hatte, nur damit ich mehr Geld verdienen und die Familie mit unterstützen konnte. Auch meine Brüder haben ihren Teil dazu beigetragen.
Nein, es war keine gute Zeit.
Aber sie hat mich stärker gemacht und mir Sicherheit im Umgang mit Leid gegeben – im Blick auf andere und hoffentlich auch für mein eigenes Leben, falls mich einmal schweres Leid trifft.
Wenn Paulus also davon spricht, dass das Leid den Menschen erziehen kann, dann kann ich ihm aus meiner eigenen Erfahrung heraus zustimmen.
Das Leben bringt uns manchmal harte Prüfungen, die uns für das zurüsten können, was noch kommt.
Heute spielt das auch eine wichtige Rolle für die persönliche Resilienz.
(Anm.: Die Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.)

Aber – und das ist mir wichtig – das kann auch ganz anders ausgehen.
In meiner Arbeit in der Psychiatrie sehe ich oft, dass Menschen an diesen „Züchtigungen des Lebens“ zerbrechen.
Darum glaube ich:
Leid ist weder ein gutes Erziehungsmittel noch ein Weg, den man sich wünschen sollte.
Ich selbst könnte gut darauf verzichten.
Nur: das Leben lässt es nicht zu, Leid einfach zu vermeiden.
Also versuche ich, damit umzugehen, damit es mich nicht zerstört, sondern ich – durch den bewussten Umgang damit – vielleicht sogar in meinem Leben gestärkt werde, und so besser gewappnet bin für die Herausforderungen meines Lebens und meines Glaubens.