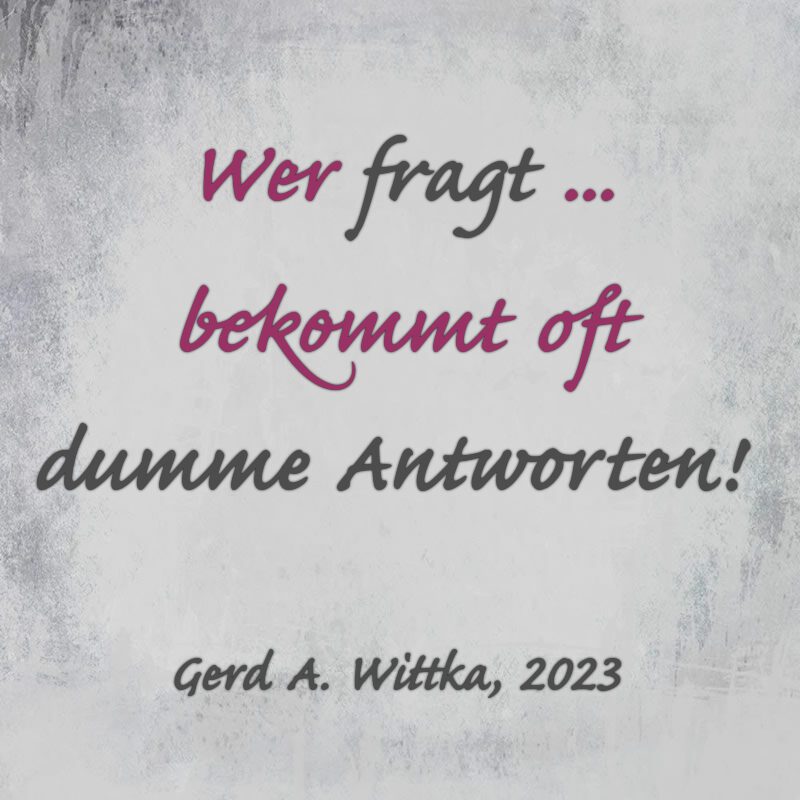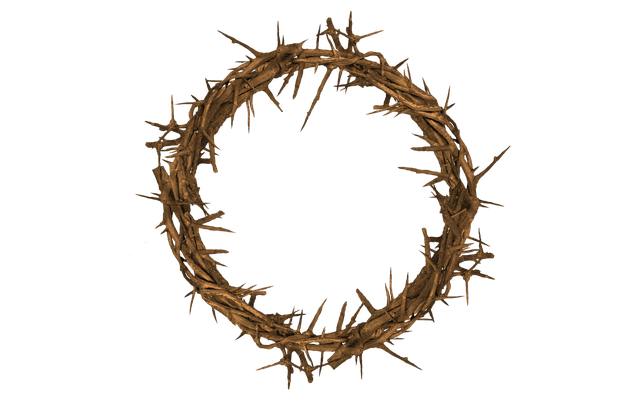Politik und Gebet
Was uns nicht (mehr) selbstverständlich ist

Sicherlich werden einige innerlich zusammenzucken, wenn sie den Titel dieses Beitrags lesen.
Okay, zusammenzucken darf man, aber dann bitte sich auch die Gelegenheit nicht nehmen lassen, darüber in Ruhe mal nachzudenken.
Ich jedenfalls habe es getan, als ich heute Morgen folgendes Zitat fand:
„Ohne Gebet und Mystik wird Politik schnell unerbittlich und barbarisch …“
Edward Schillebeeckx (1914-2009), belgischer Dominikaner und römisch-katholischer Theologe, zitiert nach „TE DEUM“, Ausgabe Januar 2025, S. 113
Politik und Gebet
Betende Politiker:innen – sind sie uns bekannt?
Nein, ich meine jetzt nicht jene heuchlerischen Politiker:innen, die sich gerne in Kirchen, Moscheen oder Synagogen ablichten lassen, womöglich noch bei einer Teilnahme an Gottesdiensten, aber zugleich menschenmordende Kriege beginnen und anderen Menschen, Völkern und Nationen ihr Existenzrecht absprechen.
Ich meine jene Politiker:innen, die als solche aktiv und mitgestaltend tätig sind, aber zugleich in ihrem Leben, mitunter auch recht persönlich, das persönliche und/oder öffentliche Gebet pflegen.
Ich meine jene, die nicht immer nur das sprichwörtliche „Herr, Herr, ….“ in den Mund nehmen, wie es schon Christus in Mt 7, 21 kritisiert:
„Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.“
Matthäus-Evangelium, Kapitel 7 Vers 21
Sondern ich meine jene Politiker:innen, die wirklich versuchen, aus ihrem Glauben her Politik zu gestalten, die ihr Leben und Handeln, sowohl das persönliche wie das politische Handeln, bereit sind, auf dem Hintergrund ihres Glaubens kritisch zu hinterfragen, zu gestalten und zu leben.
Kennst du solche Politiker:innen?
Wenn du sie nicht kennst, ist das auch kein Indiz dafür, dass es sie nicht gibt.
Denn diese Sorte von Politiker:innen machen häufig kein großes Aufheben um ihren Glauben. Man muss sie vielleicht schon persönlicher kennen, um zu wissen, welche Rolle ihr Glaube in ihrem Leben und ihrem politischen Wirken spielt.
Es ist die persönliche Offenheit, in ihrem Leben und persönlichen wie beruflichen Alltag die religiöse Frage mit einfließen zu lassen, ohne aber andere damit indoktrinieren zu wollen.
Der Glaube wird für sie zu einem Entscheidungs- und Gestaltungsfaktors ihres Lebens, welches einher geht mit einer persönlichen Gottesbeziehung, die ihren Ausdruck im persönlichen wie öffentlichen Gebet findet.
Ich denke, an solche Menschen dachte Edward Schillebeeckx.
Die Ansichten solcher Menschen führen nicht zwangsläufig dazu, dass ihre Ansichten von allen oder zumindest vielen geteilt wird.
Darum geht es auch nicht zu aller erst.
Sondern es geht darum, dass diese Menschen sich und ihr ganzes Leben ins Verhältnis setzen können zu einer ‚höheren Macht‘, denen sie sich verbunden und verantwortlich fühlen und sie zugleich erkennen lässt, dass weltliche Macht begrenzt ist und auch begrenzt sein muss, damit sie wahrhaft human sein kann.
Unbegrenzte Machtansprüche führen zum Beispiel zu Unerbitterlichkeit und Barbarei, wie es Schillebeeckx sicherlich gemeint hat.
Und solche Politiker:innen kennen wir – Gott sei’s geklagt – leider auch in unserer Zeit zuhauf.
Wir dürfen uns – wie ich finde – glücklich schätzen, wenn wir jedoch auch Politiker:innen finden, vielleicht sogar kennen, für die Glaube, Spiritualität und persönliches wie öffentliches Gebet zu ihrem Leben dazu gehören und die aus diesem Bewusstsein zu leben und zu wirken versuchen.
Ich denke, einer von ihnen ist in diesen Tagen im hohen Alter verstorben: Jimmy Carter, ehemaliger Präsident der USA.
Es gibt sie auch nicht so weit von uns entfernt, hier bei uns in Europa, in Deutschland, in NRW, im Ruhrgebiet, … in der Nachbarschaft und in den eigenen Familien- und Freundeskreisen.
Und dafür bin ich dankbar und es hilft mir, ihnen leichter meine politische Macht und Verantwortung als Staatsbürger dieses Landes durch Wahlen an sie zu übertragen.