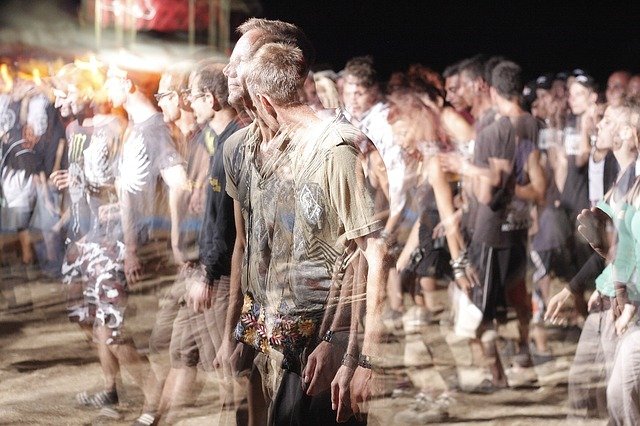Kirche: anschlussfähig bleiben
Auf dem „Tag der pastoralen Dienste“ unseres Bistums am vergangenen Donnerstag, haben sich Seelsorgende der verschiedenen Berufsgruppen getroffen, um über die Herausforderungen der Seelsorge in dieser Zeit zu diskutieren und zu beraten.
Der Referent dieses Tages, Herr Andreas Feige, prägte den Satz:
„Wir müssen anschlussfähig bleiben für die verschiedenen Gottesbilder und für verschiedene Sozialformen der Kirche!“
Mag. Theol. Andreas Feige, Freiburg
Diese Aussage verbindet sich gut zu den Lesungen des 6. Sonntag der Osterzeit, zu dem der nachfolgende Impuls ist:

Der Heilige Geist – Wegweiser in Zeiten des Wandels
Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles verändert – in der Politik, in der Gesellschaft und auch in der Kirche.
Manche Dinge, die uns früher Sicherheit gegeben haben, verschwinden.
Gewohnheiten, an denen unser Herz hängt, geraten ins Wanken.
Neue Lebensweisen, viele Kulturen und unterschiedliche Meinungen prägen unsere Welt.
Das spüren wir auch in unseren Kirchengemeinden, im Glaubensleben – und vielleicht sogar in unserem eigenen Herzen.
Aber: Solche Zeiten des Wandels gab es immer schon.
Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir: Auch die ersten Christinnen und Christen standen vor großen Veränderungen.
Nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt mussten sich die jungen Gemeinden neu orientieren.
Sie hatten viele Fragen:
• Wer gehört zur Gemeinde?
• Können Menschen, die keine Juden sind, auch Christen werden?
• Müssen sie sich beschneiden lassen oder sich an jüdische Speisevorschriften halten?
• Was tun mit Menschen, die anders leben oder glauben?Es ging also nicht nur um Regeln, sondern um die Frage: Wer sind wir als Kirche?
Und es gab damals heftige Meinungsverschiedenheiten.
Kommt uns das bekannt vor?
Auch wir heute haben schwierige Fragen:
• Dürfen Menschen, die nach einer Scheidung wieder geheiratet haben, zur Kommunion gehen?
• Wie gehen wir mit homosexuellen Menschen in der Kirche um?
• Dürfen gleichgeschlechtliche Paare gesegnet oder sogar kirchlich getraut werden?
• Können wir gemeinsam mit Christinnen und Christen anderer Konfessionen das Abendmahl feiern?
• Und: Können Frauen zu Diakoninnen geweiht werden?Diese Fragen sind nicht leicht.
Sie betreffen unseren Glauben ganz direkt.
Und oft sind Ängste damit verbunden – die Angst, dass wir unsere Identität verlieren.
Die Angst, dass der Glaube verwässert wird.
Oder dass wir mit unseren Traditionen brechen.
Und trotzdem:
Jede Zeit hat ihre Fragen.
Jede Gemeinde hat ihre Herausforderungen.
Immer wieder geht es darum, diese Fragen im Licht des Evangeliums zu betrachten – und im Vertrauen auf den Heiligen Geist.
In der Apostelgeschichte (Kapitel 15) lesen wir von einem wichtigen Moment: dem sogenannten Apostelkonzil.
Die Gemeinde in Jerusalem überlegte, wie sie mit den vielen Nichtjuden umgehen sollte, die Christen wurden.
Am Ende sagten sie:
„Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch nur wenige Dinge aufzuerlegen: Ihr sollt kein Götzenfleisch essen, kein Blut, nichts Ersticktes und keine Unzucht treiben.“ (Apg 15,28)
Man könnte sagen: Die ersten Christinnen und Christen fanden einen Kompromiss.
Aber nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen.
Sie vertrauten darauf, dass Gott durch seinen Geist wirkt – nicht durch äußere Regeln.
Sie schlossen niemanden aus. Sie öffneten die Tür.
Auch nach dieser ersten Einigung blieb es nicht friedlich: In Antiochia gerieten Paulus und Petrus in Streit, weil Petrus sich aus Angst vor streng gesetzestreuen Juden-Christen plötzlich von der Mahlgemeinschaft mit Heiden-Christen zurückzog. Paulus kritisierte dieses Verhalten im Galaterbrief als unehrlich, da für ihn alle Christen gleich waren – unabhängig von ihrer religiösen Herkunft.
Es ging wieder in erster Linie nicht nur ums Essen – sondern um die Frage:
Wie weit reicht unser Glaube?
Trauen wir Gott zu, dass er größer ist als unsere Grenzen?
Petrus musste erst mühsam lernen, was Gott ihm in einer Vision zeigte, die im 11. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet wird:
„Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein.“ (Apg 11,9)
All das zeigt uns:
Die Kirche ist kein festes, unbewegliches Gebäude.
Sie ist etwas Lebendiges.
Menschen diskutieren, machen Fehler, kehren um, lernen dazu.
Und mitten in allem ist der Heilige Geist – damals wie heute.
Jesus hat uns diesen Geist versprochen.
Er sagte:
„Der Heilige Geist wird euch lehren und euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,26)
Und:
„Meinen Frieden gebe ich euch – nicht wie die Welt ihn gibt.“ (Joh 14,27)
Dieser Friede ist kein Zustand, in dem alles ruhig ist.
Sondern ein Weg – ein Weg des Zuhörens, des Miteinanders, des Vertrauens.
Frieden wächst nicht durch Verbote oder Machtworte.
Frieden entsteht, wenn der Heilige Geist unsere Herzen bewegt – und unsere Gemeinden.
Darum:
Bleiben wir offen für diesen Geist.
Stellen wir unsere Fragen.
Hören wir einander zu.
Gehen wir miteinander.
Nicht alles müssen wir sofort lösen.
Aber wir können losgehen.
Im Vertrauen auf Gott.
Gemeinsam.