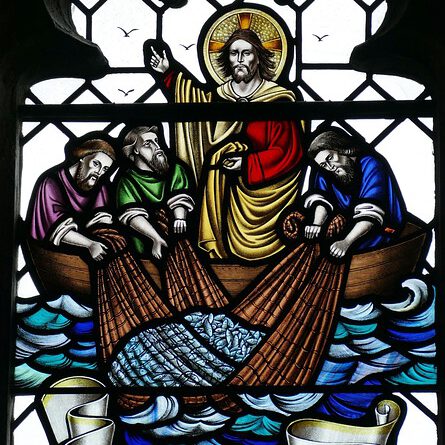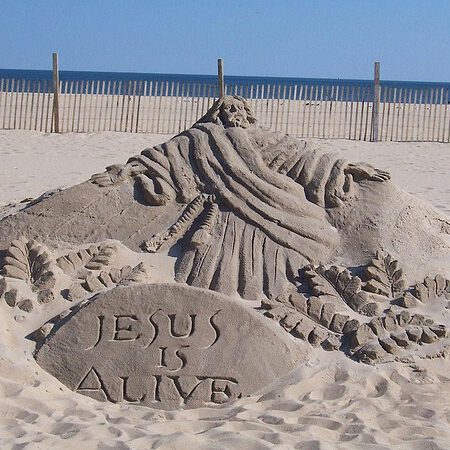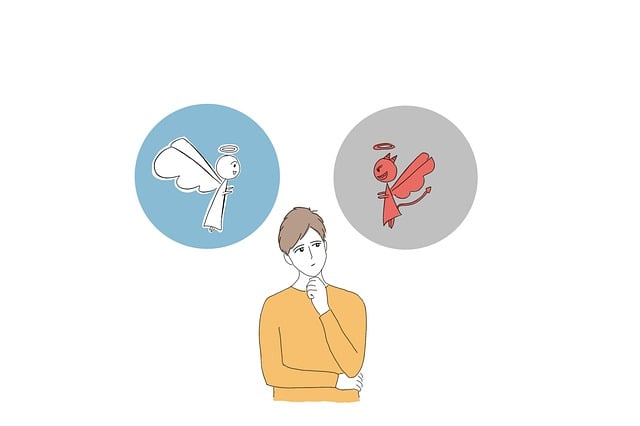Vertrauen – Friedensbereitschaft – Verantwortung
Impuls zum 14. Sonntag im Lesejahr C – 2025
Lesungstext: Lukas-Evangelium 10, 1-9
Fast jede und jeder von uns hat schon mal vom „Knigge“ gehört – einer Sammlung alter Benimmregeln, die 1788 von Adolph Freiherr Knigge in seinem Buch „Über den Umgang mit Menschen“ veröffentlicht wurde.
Viele Ratschläge daraus wirken heute überholt: Wer hält sich noch an steife Tischmanieren oder die genaue Reihenfolge beim Händegeben?
Doch die grundlegende Frage bleibt aktuell:
Wie begegnen wir einander, damit menschliche Begegnungen gelingen kann?
Im Evangelium schickt Jesus 72 Menschen zu zweit aus – seine „Arbeiter im Weinberg des Herrn“. Er weiß, dass er nicht allein überall hingehen kann, um seine Botschaft zu verkünden.
Deshalb delegiert er diese Aufgabe an andere.
Delegation bedeutet hier nicht nur, sich Arbeit vom Hals zu schaffen, sondern Vertrauen zu schenken und Kompetenz anzuerkennen: Jesus vertraut darauf, dass diese zweiundsiebzig genau so wichtig und fähig sind wie er selbst.
Das ist eine Grundhaltung, die wir uns heute auch gerade in unserer Kirche mehr bewusst werden dürfen!

Denn: Warum ist echte Delegation heute so wichtig?
- Praktische Notwendigkeit. Kein Einzelner kann ewig und überall wirken.
- Gemeinschaft stärken. Wer Verantwortung teilt, zeigt: Einander zu vertrauen ist Teil unseres Glaubens.
- Vielfalt der Begabungen. Jeder bringt verschiedene Fähigkeiten mit, die gemeinsam mehr bewirken als einsame Anstrengung.
Auch in unserer Kirche müssen wir heute immer wieder neu überlegen:
- Welche Aufgaben gebe ich weiter?
- Wo vertraue ich anderen, statt alles allein machen zu wollen?
- Und wie tragen wir so gemeinsam die Botschaft, dass Jesus Liebe, Frieden und Hoffnung ist?

Am Ende der traditionellen lateinischen Messe klingt der Satz „Ite, missa est!“ – „Geht, ihr seid gesendet!“ – wie ein Echo der Worte Jesu damals. Diese Sendung betrifft nicht nur Priester oder Hauptamtliche, sondern uns alle: Was können wir in unserem Alltag weitersagen und -leben?
Jesus zeigt uns vier Grundhaltungen für unseren Weg auf:
- Leichtes Gepäck.
Lass los, was dich daran hindert, aufmerksam zu sein: alte Sorgen, falsche Erwartungen, übertriebene Gewohnheiten. - Friedfertigkeit.
Beginne jede Begegnung mit einem Wort des Friedens: „Der Friede sei mit dir!“ Diese Geste schenkt Hoffnung und öffnet Herzen. - Vertrauen.
Als Gast vertraust du darauf, dass dein Gegenüber dir Gutes tun will. Genauso kannst auch du Vertrauen schenken – indem du zuhörst, teilst und dich einlässt. - Beständigkeit.
Bleib an einem Ort, in Beziehungen, in Projekten – auch wenn es anstrengend wird. Echter Zusammenhalt entsteht durch Geduld und Ausdauer.

Der „Knigge“ lehrte uns zwar höfliches Benehmen, aber Jesus zeigt uns, dass es im Kern um viel mehr geht: um Vertrauen, gemeinsames Tragen von Verantwortung und eine Haltung des Friedens.
Wenn wir „ausgesendet“ werden, tragen wir diese Haltungen in unseren Alltag – in Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft und darüber hinaus.
So ist das heutige Evangelium mehr als eine alte Benimmregel.
Sie ist eine lebendige Einladung zu echter Menschlichkeit, in der es auch Raum für die Verkündigung der Frohen Botschaft gibt.